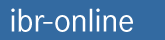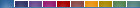Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Aktuelle Urteile in allen Sachgebieten
Online seit 6. März
IBRRS 2025, 0618 Vergabe
Vergabe
OVG Sachsen, Urteil vom 25.09.2024 - 6 A 118/20
1. Wird der Zuwendungsempfänger dazu verpflichtet, eine bestimmte Verdingungsordnung anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, hat er die Einhaltung dieser Zuwendungsvoraussetzung der Bewilligungsbehörde durch die Vorlage der Vergabedokumentation nachzuweisen.
2. Der Zuwendungsgeber darf den Zuwendungsbescheid (teilweise) widerrufen, wenn der Zuwendungsempfänger eine mit dem Zuwendungsbescheid verbundene Auflage nicht erfüllt hat.
3. Die Unterlassung einer EU-weiten Ausschreibung trotz Überschreiten des Schwellenwerts ist ein schwerer Vergaberechtsverstoß. Gleiches gilt für die Durchführung einer freihändigen Vergabe oder einer beschränkten Ausschreibung ohne Vorliegen der dafür notwendigen Voraussetzungen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0607
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17.01.2025 - 14 S 376/24
1. Das BauGB stellt im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Hs. 1 BauGB) in der Fassung vom 03.07.2023 (n. F.) allein darauf ab, dass die Bekanntmachung des Entwurfs eines Bauleitplans "vor Beginn der Veröffentlichungsfrist" erfolgen muss.*)
2. Für den Beginn der Veröffentlichungsfrist ist der Beginn des Tages der Veröffentlichung (§ 187 Abs. 2 BGB) maßgebend.*)
3. Für die ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Hs. 1 BauGB) ist grundsätzlich nicht das ggf. frühere Verteilungs-, sondern das spätere Erscheinungsdatum des Amtsblatts maßgeblich für den Bekanntmachungserfolg.*)
4. Ein Verstoß gegen das Erfordernis, dass die Bekanntmachung "vor Beginn der Veröffentlichungsfrist" erfolgen muss, kann durch die Dauer der auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Veröffentlichung geheilt werden (Übertragung der Rechtsprechung zu § 3 Abs. 2 BauGB a. F., vgl. BVerwG, Beschluss vom 23.07.2003 - 4 BN 36.03, NVwZ 2003, 1391 = IBRRS 2003, 2389).*)
5. Zu Vorsorgeschutzabständen als weiche Tabukriterien in der sachlichen Teilflächennutzungsplanung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0619
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Kreuzberg, Urteil vom 11.12.2024 - 4 C 5129/24
1. Eine Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch liegt nur vor, wenn durch die Anmietung lediglich ein vorübergehender Wohnbedarf, der aus besonderem Anlass entsteht (etwa Urlaub, Um- oder Neubau der eigentlichen Wohnung), gedeckt werden soll, nicht hingegen, wenn ein allgemeiner Wohnbedarf mangels anderweitiger Bleibe lediglich kurzfristig und vorübergehend befriedigt werden kann.
2. Bei Studierenden ist vorübergehender Gebrauch allenfalls dann anzunehmen, wenn sie die Wohnung nur semesterweise anmieten, da sie sich dann ersichtlich einen Wechsel in eine andere Wohnung nach dem Semester vorbehalten wollen.
3. Der im Mietvertrag vereinbarte Vertragszweck "Studium" lässt nicht per se den Schluss auf einen nur vorübergehenden Gebrauch zu.
4. Der Abschluss eines Kettenmietvertrags mit jeweils kurzer Mietdauer über ein Zimmer in einer Wohnung mit einem Studenten als Mieter ist als Versuch der Umgehung der Mietpreisbremse zu werten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0612
 Wohnungseigentum
Wohnungseigentum
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 20.02.2025 - 2-13 S 42/24
1. Ein Beschluss, die Kosten der Erneuerung einer Heizungsanlage nach dem Objektprinzip zu verteilen, kann sich im Rahmen des weiten Ermessens der Wohnungseigentümer bei der Änderung von Kostenverteilerschlüsseln (§ 16 Abs. 2 WEG) halten.*)
2. Gibt eine Regelung in der Teilungserklärung sinngemäß nur den seinerzeit geltenden Rechtsstand (hier zur Änderung von Kostenverteilerschlüsseln) wieder, steht dies der Anwendung des neuen Rechts nicht entgegen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0357
 Notare
Notare
OLG München, Beschluss vom 03.12.2024 - 33 W 1034/24
1. Das notarielle Nachlassverzeichnis ist eine Tatsachenbescheinigung des Notars übe seine Ermittlungen und Wahrnehmungen. Sie wird durch Errichtung einer öffentlichen Zeugnisurkunde über die vom Notar festgestellten Tatsachen errichtet; eine Verlesung findet nicht statt. Der Pflichtteilsberechtigte hat an einer Anwesenheit bei diesem Vorgang grundsätzlich kein Interesse.*)
2. Das Zuziehungsrecht des Pflichtteilsberechtigten bei der Aufnahme des amtlichen Verzeichnisses durch einen Notar besteht nicht bei einzelnen notariellen Ermittlungshandlungen.*)
3. Der Pflichtteilsberechtigte hat grundsätzlich keinen Anspruch, die vom Notar im Rahmen der Erstellung des notariellen Nachlassverzeichnisses auszuwertenden Unterlagen einzusehen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0616
 Schiedswesen
Schiedswesen
OLG Frankfurt, Beschluss vom 06.02.2025 - 26 Sch 21/24
1. Auch im Verfahren auf Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen gilt der Grundsatz, dass das Kostenrisiko voreilig gestellter Anträge den Antragsteller treffen muss.
2. Beinhaltet der für vollstreckbar zu erklärende Schiedsspruch eine Ratenzahlungsvereinbarung und kommt der Schuldner dieser Ratenzahlungsvereinbarung pflichtgemäß nach, so hat regelmäßig der Gläubiger die Kosten des Vollstreckbarerklärungsverfahrens zu tragen, wenn er trotz fehlender Fälligkeit der ausstehenden Raten einen Antrag auf Vollstreckbarerklärung stellt und keine Anhaltspunkte dafür darlegt, dass der Schuldner bei Fälligkeit nicht erfüllen wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0560
 Prozessuales
Prozessuales
BGH, Beschluss vom 28.01.2025 - VIII ZB 39/24
1. Erklären die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt, ist über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei ist der mutmaßliche Ausgang des Verfahrens zu berücksichtigen.
2. Es ist nicht Zweck einer Kostenentscheidung, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären oder das Recht fortzubilden. Grundlage der Entscheidung ist lediglich eine summarische Prüfung, bei der das Gericht grundsätzlich davon absehen kann, in einer rechtlich schwierigen Sache nur wegen der Verteilung der Kosten alle für den hypothetischen Ausgang bedeutsamen Rechtsfragen zu klären.
3. Bleibt eine in der Instanzrechtsprechung und im Schrifttum umstrittene Rechtsfrage offen, ist ungewiss, welchen Ausgang das Verfahren genommen hätte. Mangels anderer Verteilungskriterien sind die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben.
 Volltext
Volltext
Online seit 5. März
IBRRS 2025, 0606 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamburg, Urteil vom 06.11.2024 - 4 U 89/21
1. Für die Verteilung des "Baugrundrisikos" kommt in erster Linie auf die Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen der Parteien an.
2. Der Auftragnehmer kann davon ausgehen, dass der (öffentliche) Auftraggeber sich an die Ausschreibungsregelungen der VOB/A halten will, also insbesondere möglichst klar und eindeutig ausgeschrieben hat und dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Risiko auferlegen will (sog. vergaberechtskonforme Auslegung).
3. Speziell für die Unsicherheit bezüglich der Bodenbeschaffenheit sind Eventualpositionen zulässig, sofern der Auftraggeber die Bodenverhältnisse sachgerecht hat untersuchen lassen und nach dem geotechnischen Gutachten Unsicherheitsfaktoren bleiben.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0611
 Vergabe
Vergabe
OLG Naumburg, Beschluss vom 11.10.2024 - 6 Verg 2/24
1. Vergaberechtsschutz wird grundsätzlich nur in einem bereits begonnenen und noch laufenden Vergabeverfahren gewährt. Ein wirksam erteilter Zuschlag kann von der Nachprüfungsinstanz nicht aufgehoben werden. Die Bieter können jedoch die Unwirksamkeit eines öffentlichen Auftrags feststellen lassen.
2. Ein Zuschlagsschreiben, dem als Anlage eine (hier: Rahmen-)Vertragsvereinbarung mit Änderungen gegenüber dem Entwurf beigefügt ist, führt nicht zum Vertragsschluss. Ein solches Schreiben ist als Ablehnung des Angebots verbunden mit der Unterbreitung eines neuen Angebots zu verstehen (sog. modifizierter Zuschlag), das wiederum vom Bieter anzunehmen ist.
3. Die Erteilung eines modifizierten Zuschlags ist vergaberechtswidrig, weil Verhandlungen über den Inhalt der abzuschließenden Vereinbarung nach der Vorlage des endgültigen Angebots nicht mehr zulässig sind. Dieser Vergabeverstoß führt aber nicht zur Unwirksamkeit des Vertragsschlusses.
IBRRS 2025, 0579
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Schleswig, Beschluss vom 13.02.2025 - 2 B 35/24
1. Unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Gebietserhaltungsanspruches kann ein Nachbar das Eindringen von der Nutzungsart nach unzulässigen Bauvorhaben in das Baugebiet, in welchem sein Grundstück belegen ist, abwehren.
2. Einem "Baugebiet" sind nur solche Grundstücke zuzurechnen, deren bauliche Nutzungen in einem wechselseitigen Austauschverhältnis stehen; nur in diesem Fall kann ein Eigentümer, der sein Grundstück den planungsrechtlichen Vorgaben bzw. den aus dem Planersatzrecht des § 34 BauGB folgenden faktischen Vorgaben entsprechend nutzt, schutzwürdig erwarten, dass sich andere - den gleichen Vorgaben unterworfene - Eigentümer ebenfalls an diese Vorgaben halten.
3. Handelt es sich um eine Gemengelage, besteht von vornherein kein Gebietserhaltungsanspruch der Antragstellerin.
4. Dem Inhaber eines Gewerbebetriebs kann ein Abwehranspruch gegen heranrückende Wohnbebauung zustehen, wenn diese neu hinzutretende Wohnbebauung unzumutbaren Immissionen ausgesetzt wäre und durch die neu hinzutretende Wohnbebauung vorhandene Konflikte verschärft oder erstmalig neue Nutzungskonflikte begründet würden. Etwaige Vorbelastungen, die eine schutzbedürftige Nutzung an einem Standort vorfindet, der durch eine schon vorhandene emittierende Nutzung vorgeprägt ist, sind schutzmindernd zu berücksichtigen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0600
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Bottrop, Urteil vom 09.01.2025 - 8 C 284/23
1. Wird der Herausgabeanspruch des Vermieters im Wege der Zwangsräumung durchgesetzt, bedeutet dies keine Erfüllung des Räumungsschuldners i.S.v. § 362 BGB.
2. Eine vorübergehende Nutzungsuntersagung stellt keinen Kündigungsgrund für den Vermieter dar.
3. Tritt in einer Wohnung ein Abwasserschaden auf, der zu unzumutbaren Fäkalgerüchen führt, ist die Miete zu 100% gemindert.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0494
 Wohnungseigentum
Wohnungseigentum
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 23.01.2025 - 2-13 S 12/24
1. Wird eine Anfechtungsklage rechtskräftig abgewiesen, liegt darin auch die Feststellung, dass die angefochtenen Beschlüsse nicht nichtig sind.
2. Die Einhaltung der Klagefrist nach § 45 WEG ist eine Frage der Begründetheit der Anfechtungsklage.
3. Die Forderung einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann nicht einseitig durch Beschluss ohne Zustimmung des Wohnungseigentümers (= Schuldner) gestundet werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0378
 Immobilien
Immobilien
OLG Celle, Beschluss vom 09.09.2024 - 20 W 50/24
1. Der Antrag des Finanzamtes auf Eintragung einer Zwangssicherungshypothek ist ein Ersuchen i.S. des § 38 GBO. Damit ist der Inhalt des eigentlichen Steuerbescheids als Vollstreckungstitel der Nachprüfung durch das Grundbuchamt entzogen und das Ersuchen ersetzt aus Sicht des Grundbuchamtes den Titel. Hieraus folgt, dass die im Ersuchen als zu besichernd bezeichneten Forderungen - d.h. die Einkommenssteuerforderungen ebenso wie die Zinsen und Säumniszuschläge - beim Vollzug der Eintragung als tituliert zu behandeln sind.*)
2. Im "titelersetzenden" Ersuchen bereits kapitalisierte Zinsen und Säumniszuschläge sind als Hauptforderung einzutragen bzw. dieser hinzuzurechnen.*)
3. § 197 Abs. 2 BGB greift von vornherein nur insoweit, als die titulierten Ansprüche auf Leistungen gerichtet sind, die nach Unanfechtbarkeit der Anspruchsfeststellung bzw. nach dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fällig werden.
4. Eine Verletzung gesetzlicher Vorschriften i.S.v. § 53 Abs. 1 GBO kann auch dann vorliegen, wenn die Gesetzesauslegung des Grundbuchamts rechtlich vertretbar erscheint, z.B. weil - wie hier - andere Obergerichte von derselben Auffassung ausgehen. Maßgeblich ist allein die objektive Rechtslage.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0608
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
AG Hanau, Beschluss vom 03.03.2025 - 32 C 226/24
Die automatisierte Rückmeldung an den Absender einer E-Mail, die Adresse werde nicht mehr verwendet und die eingegangene E-Mail nicht weitergeleitet, steht dem Zugang der E-Mail nicht entgegen. Der Absender kann jedoch nebenvertraglich zur Verwendung eines anderen Kommunikationswegs verpflichtet sein.*)
IBRRS 2025, 0340
 Zwangsvollstreckung
Zwangsvollstreckung
BGH, Beschluss vom 07.01.2025 - VII ZB 30/23
Im Klauselerteilungsverfahren nach §§ 724 ff. ZPO können für ein gem. § 93Abs. 1 Satz 2 ZVG zu berücksichtigendes Besitzrecht eines Dritten nur solche Umstände Berücksichtigung finden, nach denen dieses Besitzrecht für das Klauselerteilungsorgan ohne jeden vernünftigen Zweifel erkennbar, also evident ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2558
 Notare
Notare
BGH, Urteil vom 08.08.2024 - III ZR 287/23
Worüber gem. § 17 Abs. 1 BeurkG i.R.d. Bestellung einer Grundschuld oder - über § 24 Abs. 1 BNotO - wie bei einer Beurkundung zu belehren ist, ist eine Rechtsfrage, die vom Tatrichter ohne weiteren Sachvortrag des Klägers zum Inhalt der Belehrung zu beantworten ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0602
 Prozessuales
Prozessuales
BGH, Beschluss vom 11.02.2025 - XI ZR 32/24
Ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs setzt eine gewisse Evidenz der Gehörsverletzung voraus, das heißt, im Einzelfall müssen besondere Umstände vorliegen, die deutlich ergeben, dass das Vorbringen der Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei der Entscheidung ersichtlich nicht erwogen worden ist.
 Volltext
Volltext
Online seit 4. März
IBRRS 2025, 0590 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Nürnberg, Beschluss vom 14.01.2025 - 2 W 2077/24 Bau
1. Jede inhaltliche Abweichung von den VOB/B führt dazu, dass diese nicht als Ganzes vereinbart ist. Dies gilt unabhängig davon, welches Gewicht der Eingriff hat.
2. Ob eine inhaltliche Abweichung von der VOB/B anzunehmen ist, ist nach dem Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung zu ermitteln.
3. Eine Bestimmung, nach der "zusätzliche Aufträge bzw. Nachträge [...] zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform" bedürfen, weicht inhaltlich von der VOB/B ab.
4. Welche Leistungen von der Leistungsbeschreibung erfasst und mit der vereinbarten Vergütung abgegolten sind, ist durch Auslegung des Vertrags aus der Sicht einer objektiven Vertragspartei zu ermitteln. Dabei sind das gesamte Vertragswerk und auch dessen Begleitumstände zugrunde zu legen.
5. Es gibt keine allgemeine Regel, dass Unklarheiten generell zulasten des Unternehmers oder umgekehrt zulasten des Bestellers zu lösen wären.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0596
 Vergabe
Vergabe
VK Bund, Beschluss vom 30.12.2024 - VK 2-103/24
1. Aus den Abgabemengen aus dem vergangenen Referenzzeitraum kann belastbar auf die zukünftigen Abgabemengen geschlossen werden. Die Kalkulierbarkeit ist weder unmöglich noch unzumutbar.
2. Einer exakten Mengenangabe bedarf es bei Rahmenverträgen nicht. Ein öffentlicher Auftraggeber muss bei Rahmenverträgen lediglich die maximalen Abnahmemengen bekannt geben.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0578
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 18.02.2025 - 1 MN 147/24
Will die planende Gemeinde einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit zentrenrelevantem Sortiment gem. Plansatz Nr. 2.3 Abs. 05 Satz 3 LROP 2017 ausnahmsweise in einer städtebaulich nicht integrierten Lage ansiedeln, muss sie im Einzelnen belegen, dass sie nicht über einen geeigneten Standort in städtebaulich integrierter Lage verfügt. Ob eine Ausnahme gerechtfertigt ist, unterliegt vollständiger gerichtlicher Überprüfung (Bestätigung der Senatsrspr., vgl. Senatsbeschluss vom 29.04.2021 - 1 MN 154/20 -, IBRRS 2021, 1407).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0569
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
VG Karlsruhe, Urteil vom 05.02.2025 - K 505/24
1. Die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets verschiebt mit Blick auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung die "Verfahrenslast" auf den Antragsteller.*)
2. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens durch Einholung eigener Gutachten zu ermöglichen. Die Genehmigungsvoraussetzungen der vom Antragsteller beizubringenden Bauvorlagen, zu denen gegebenenfalls auch (wasserwirtschaftliche) Gutachten gehören.*)
3. Die Zuständigkeitskonzentration auf die Baurechtsbehörde in § 84 Abs. 2 Satz 1 VVG bewirkt, dass allein das Fehlen der wasserrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen die Behörde auch zur Versagung der Baugenehmigung berechtigt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3268
 Wohnungseigentum
Wohnungseigentum
LG Stuttgart, Beschluss vom 30.05.2023 - 19 S 34/22
1. Die Pflicht des Verwalters, Beitragsforderungen gegen säumige Wohnungseigentümer geltend zu machen (vgl. § 27 Abs. 1 Nr. 4 WEG a.F.), entfaltet keine Schutzwirkung zu Gunsten anderer Eigentümer. Die Pflicht des Verwalters dient dem Ziel, die Wohnungseigentümergemeinschaft mit der notwendigen Liquidität auszustatten.
2. Der Verwalter ist gegenüber einem Erwerber, der gemeinsam mit dem Veräußerer für Beiträge haftet, nicht verpflichtet, diese zunächst beim Veräußerer geltend zu machen. Aus der insoweit maßgeblichen Perspektive der Eigentümergemeinschaft besteht kein Haftungsvorrang des Veräußerers.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0584
 Immobilien
Immobilien
KG, Beschluss vom 30.01.2025 - 1 W 21/24
Ein in einer vor dem 01.12.2020 vereinbarten Gemeinschaftsordnung enthaltener Zustimmungsvorbehalt zu Gunsten "der Mehrheit der übrigen Wohnungseigentümer" zur Veräußerung eines Wohnungseigentums ist ergänzend dahin auszulegen, dass nicht die Wohnungseigentümer individuell, sondern die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zustimmungsbefugt sind. Öffentlich beglaubigte Zustimmungserklärungen einer Mehrheit, aber nicht aller Wohnungseigentümer genügen dann zum Nachweis der Wirksamkeit einer Auflassung gegenüber dem Grundbuchamt nicht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0380
 Zwangsvollstreckung
Zwangsvollstreckung
LG Memmingen, Urteil vom 16.07.2024 - 36 O 1607/23
1. § 50 Abs. 2 Nr. 2 ZVG erfasst den Fall eines Wegfalls des Rechts nach Wirksamwerden des Zuschlags.
2. Die Zuzahlungspflicht des Erstehers besteht auch bei vorheriger Befriedigung des Eigentümers des versteigerten Grundstücks.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0562
 Prozessuales
Prozessuales
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 06.02.2025 - 2 U 91/24
1. Ein eingeschränkter Rechtsmittelantrag ist für die Bemessung des Streitwerts ohne Bedeutung, wenn er offensichtlich nicht auf die Durchführung des Rechtsmittels gerichtet ist, sondern der Verringerung der Kostenlast dient. § 47 GKG hat nicht den Zweck, einem Rechtsmittelkläger, der sein Rechtsmittel überhaupt nicht durchführen will, zu einer Verringerung der Kostenlast zu verhelfen (Anschluss an BGH, Beschluss vom 14.02.1978 - GSZ 1/77, NJW 1978, 1263).*)
2. Ob ein Rechtsmittel "offensichtlich" nicht durchgeführt werden soll, kann zwar in der Regel nur aufgrund eindeutiger objektiver Umstände angenommen werden. Für diese Annahme kann aber schon ein krasses Missverhältnis zwischen der Beschwer des Rechtsmittelführers und der mit dem Rechtsmittelantrag nur noch verfolgten Urteilsabänderung reichen. Eine dementsprechende Bewertung kann ferner auch in anderen Fällen jedenfalls zusammen mit der späteren Rücknahme des krass eingeschränkten Rechtsmittelantrages veranlasst sein.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 3. März
IBRRS 2024, 3355 Bauträger
Bauträger
OLG München, Beschluss vom 09.08.2022 - 20 U 3568/21 Bau
1. Die Ausübung eines Kündigungs- oder Rücktrittsrechts kann treuwidrig und damit unwirksam sein, wenn sich der Erklärende widersprüchlich verhält (hier bejaht).
2. Ein Rücktritt des Unternehmers vom Vertrag wegen Verzugs des Bestellers mit der Zahlung einer Kaufpreisrate scheidet aus, wenn sich der Unternehmer seinerseits in Gläubigerverzug befindet, weil er die von ihm geschuldete und verlangte Gegenleistung (hier: Besitzübergabe) nicht anbietet.
3. Ein mangelbedingtes Leistungsverweigerungsrecht des Bestellers besteht auch in den Fällen, in denen die Abschlagsforderung gemäß vertraglichem Zahlungsplan nach Baufortschritt fällig werden. Dabei trifft den Unternehmer die Beweislast für die Vertragsgemäßheit seiner Leistung.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0587
 Vergabe
Vergabe
OLG Koblenz, Beschluss vom 02.07.2024 - Verg 1/24
1. Die gegen einen Kostenbeschluss nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien gerichtete sofortige Beschwerde des öffentlichen Auftraggebers ist bereits unzulässig, als sie sich gegen den dortigen Ausspruch zu den Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer richtet, mit dem dem Auftraggeber die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens vor der Vergabekammer auferlegt werden, da es dem Auftraggeber insoweit an der für ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlichen materiellen Beschwer mangelt, wenn er dem Tatbestand der persönlichen Gebührenfreiheit nach § 182 Abs. 1 Satz 2 GWB, § 8 Abs. 1 Nr. 2 VwKostG unterfällt und damit von der Entrichtung der Gebühren für die Amtshandlungen der Vergabekammer befreit ist.
2. Bei einer anderweitigen Erledigung des Nachprüfungsantrags ist die Entscheidung nach § 182 Abs. 4 Satz 3 Hs. 1 GWB, wer die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen anderer Beteiligter zu tragen hat, nach billigem Ermessen zu treffen, wobei es dabei in erster Linie darauf ankommt, welcher Beteiligter im materiellen Sinne unterlegen ist oder obsiegt hat bzw. bei einer Fortführung unterlegen wäre oder obsiegt hätte.
3. Eine § 182 Abs. 3 Satz 3 GWB vergleichbare Regelung, wonach auch Verschuldensgesichtspunkte im Rahmen der Kostenverteilung grundsätzliche Bedeutung erlangen können, findet sich in § 182 Abs. 4 GWB dem Wortlaut nach ausdrücklich nicht.
4. Die Festsetzung des Beschwerdewerts beruht auf der Grundlage einer analogen Anwendung des § 3 ZPO, da, wenn sich das Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung der Vergabekammer richtet, § 50 Abs. 2 GKG keine Anwendung findet. Der Gegenstandswert ist vielmehr in entsprechender Anwendung von § 3 ZPO nach freiem Ermessen festzusetzen, wobei es in Wesentlichen darauf ankommt, welches finanzielle Interesse der Rechtsmittelführer mit seinem Bestreben nach Abänderung der angefochtenen Entscheidung verfolgt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0549
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.11.2024 - 8 C 10894/23
1. Die Gemeinde kann sich, auch wenn sie Eigentümerin der betroffenen Grundstücke ist, bei einer Angebotsplanung nicht darauf beschränken, das den Anlass für den Bebauungsplan bildende Vorhaben zum Gegenstand ihrer Abwägungsentscheidung zu machen; vielmehr müssen hierbei denkbare, in der konkreten Planungssituation nicht völlig fernliegende Bebauungsalternativen einbezogen werden (Im Anschluss an BVerwG, Beschluss vom 30.06.2014 - 4 BN 38/13, IBRRS 2014, 2655).*)
2. Zu den Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung.*)
3. Einzelfall einer an einen Winzerbetrieb heranrückenden Wohnbebauung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0583
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Remscheid, Urteil vom 03.02.2025 - 7 C 130/24
1. Es führt allein schon die Übermittlung einer (formell) ordnungsgemäßen Abrechnung über die Betriebskosten an den Mieter zur Fälligkeit des sich hieraus ergebenden Nachforderungs- und Guthabensaldos.
2. Erst wenn der Mieter von seinem Belegeinsichtsrecht geltend macht, resultiert daraus für ihn ein Zurückbehaltungsrecht bis zur Gewährung der Belegeinsicht.
3. Nur wenn die Belegeinsicht endgültig verweigert wird, kann die Klage des Vermieters auf Leistung des Nachzahlungsbetrages nicht nur zu einer Zug-um-Zug-Verurteilung, sondern zu einer Klageabweisung führen.
4. Die Belegeinsicht erstreckt sich auch auf die Zahlungsbelege; allerdings nur dann, wenn der Mieter die Einsichtnahme in die entsprechenden Zahlungsbelege auch tatsächlich verlangt und der Vermieter diese ablehnt.
5. Das allgemeine Verlangen nach Belegeinsicht bezieht sich allerdings nach allgemeinem Sprachgebrauch nur auf die Belege für die umgelegten Kosten und eben nicht auf die weiteren Zahlungs- bzw. Gutschriftbelege.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0576
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
LG Lübeck, Beschluss vom 26.06.2024 - 33 C 1094/23
1. Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben.
2. Bei der Frage, ob ein Vermieter durch die Fortsetzung eines Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert wird, darf nicht allein darauf abgestellt werden, ob eine bewohnte Wohnung der Durchführung der angestrebten Verwertung entgegensteht. Vielmehr ist auch zu bewerten, ob das Mietverhältnis als solches einer Durchführung der Arbeiten entgegensteht.
3. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich der Mieter nicht bereiterklärt, seine Wohnung vorübergehend zu räumen oder eine vorübergehende Räumung oder eine Fortsetzung des Mietverhältnisses zu angepassten Konditionen aus anderen tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sind.
4. Eine Verwertungskündigung ist zulässig, wenn ein Mietobjekt durch beabsichtigte Sanierungsmaßnahmen wegfällt.
5. Die Umgestaltung einer Wohnung kann dem Wegfall einer Wohnung nur dann gleichgestellt werden mit der Folge, dass ein Kündigungsgrund in Betracht zu ziehen ist, wenn die Wohnung durch die Umgestaltung in ihrem grundlegenden Charakter wesentlich verändert wird. Dies dürfte einer grundsätzlichen Veränderung des Wohnungszuschnitts und der Wohnqualität bedürfen, die über eine reine Modernisierung hinausgeht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0582
 Wohnungseigentum
Wohnungseigentum
AG Siegburg, Urteil vom 22.07.2024 - 152 C 7/23
1. Ein Absenkungsbeschluss ist - auch als Geschäftsordnungsbeschluss verstanden - isoliert anfechtbar. Die Beschlussfassung, im Wege des Umlaufbeschlusses zu entscheiden, muss angekündigt werden (vgl. Schultzky in Jennißen, WEG, 8. Aufl., Rz. 150). Anfechtbar ist nicht erst der Folgebeschluss (a.A. AG Köln, ZMR 2022, 1013).
2. Ein Absenkungsbeschluss muss mit den Stimmen aller Eigentümer gefasst werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0570
 Immobilien
Immobilien
OLG Hamm, Urteil vom 20.01.2025 - 22 U 25/24
1. Arglistig handelt ein Verkäufer bei einer Täuschung durch Verschweigen eines offenbarungspflichtigen Mangels, wenn er den Sachmangel mindestens für möglich hält und gleichzeitig weiß oder damit rechnet und billigend in Kauf nimmt, dass sein Vertragspartner den Mangel nicht kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hätte.
2. Dagegen genügt es nicht, wenn sich dem Verkäufer das Vorliegen aufklärungsbedürftiger Tatsachen hätte aufdrängen müssen. Auch ein bewusstes Sichverschließen genügt nicht den Anforderungen, die an die Arglist zu stellen sind. Erforderlich ist die Kenntnis der den Mangel begründenden Umstände zumindest in der Form des Eventualvorsatzes. Liegt eine solche Kenntnis vor, ist es unerheblich, ob der Verkäufer daraus den Schluss auf einen Mangel im Rechtssinne zieht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0597
 Verkehrssicherungspflicht
Verkehrssicherungspflicht
OLG Hamm, Beschluss vom 21.01.2025 - 7 U 3/25
1. Die Darlegungs- und Beweislast für eine Verkehrssicherungspflichtverletzung trifft im rein deliktischen Bereich - anders im vertraglichen Bereich - allein den Geschädigten (in Fortschreibung zu BGH, Urteil vom 25.10.2022 - VI ZR 1283/20, Rn. 15 ff. m. w. N., IBRRS 2022, 3506 = IMRRS 2022, 1545; OLG Hamm, Beschluss vom 11.10.2023 - 7 U 57/23, BeckRS 2023, 48985; OLG Hamm, Beschluss vom 19.01.2023 - 7 U 119/22, BeckRS 2023, 9515).*)
2. Die Zumutbarkeit von Sicherungsvorkehrungen bestimmt sich unter Abwägung der Wahrscheinlichkeit der Gefahrverwirklichung, der Gewichtigkeit möglicher Schadensfolgen und der Höhe des Kostenaufwands, der mit etwaigen Sicherungsvorkehrungen einhergeht (im Anschluss an BGH, Urteil vom 19.07.2018 - VII ZR 251/17, Rn. 18, IBRRS 2018, 2629).*)
3. Insoweit ist anerkannt, dass Verkehrsflächen nicht permanent auf drohende Gefahren überprüft werden müssen (im Anschluss an BGH, Urteil vom 25.10.2022 - VI ZR 1283/20, Rn. 13 f., IBRRS 2022, 3506 = IMRRS 2022, 1545; BGH, Beschluss vom 11.08.2009 - VI ZR 163/08, IBRRS 2009, 3160 = IMRRS 2009, 1739; BGH, Urteil vom 05.10.2004 - VI ZR 294/03, IBRRS 2004, 4861; BGH, Urteil vom 04.10.1983 - VI ZR 98/82, IBRRS 1983, 0428), so dass auch Absperrpfosten auf öffentlich zugänglichen Wegen grundsätzlich - wie hier - nicht ständig auf ordnungsgemäße Arretierung / fehlerhaften Verschluss / Beschädigungen überprüft werden müssen (in Fortschreibung zu OLG Hamm, Beschluss vom 04.05.2022 - 7 U 20/22, NJW-RR 2022, 1615).*)
4. Eine vollständige Überbürdung des Schadens auf den Geschädigten unter dem Gesichtspunkt des Mitverschuldens ist nur ausnahmsweise in Betracht zu ziehen, wenn - wie hier nicht - das Handeln des Geschädigten von einer ganz besonderen, schlechthin unverständlichen Sorglosigkeit gekennzeichnet ist (im Anschluss an BGH, Urteil vom 28.04.2015 - VI ZR 206/14, IBRRS 2015, 1111 = IMRRS 2015, 0655; BGH, Urteil vom 20.06.2013 - III ZR 326/12, Rn. 27, IBRRS 2013, 2842; OLG Hamm, Urteil vom 17.01.2025 - 7 U 114/23, Ls. 2, IBRRS 2025, 0589).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0591
 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
BGH, Beschluss vom 25.02.2025 - VIII ZR 143/24
Zur Frage, ob dem Verbraucher beim Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer von der Musterwiderrufsbelehrung in Teilen abweichenden Widerrufsbelehrung zusätzlich eine (hier auf der Internet-Seite des Unternehmers zugängliche) Telefonnummer des Unternehmers mitgeteilt werden muss, wenn in der Widerrufsbelehrung als Kommunikationsmittel beispielhaft dessen Postanschrift und E-Mail-Adresse genannt werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0586
 Prozessuales
Prozessuales
OLG Koblenz, Beschluss vom 07.02.2024 - 12 U 713/21
1. Die Erhebung einer Klage hemmt die Verjährung nur für Ansprüche in der Gestalt und in dem Umfang, wie sie mit der Klage geltend gemacht werden. Der Umfang der Hemmung wird somit grundsätzlich durch den Streitgegenstand bestimmt.
2. Der Streitgegenstand wird wiederum bestimmt durch den Klageantrag, in dem sich die von dem Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert und den Lebenssachverhalt (Anspruchsgrund) aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet.
3. Bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen verhält es sich so, dass die wegen einer Pflichtverletzung erhobene Klage nicht die Verjährung hemmt wegen einer anderen Pflichtverletzung. Bei Schadensersatzansprüchen erstreckt sich die Hemmung zudem nicht auf andere, nicht eingeklagte Schadensfolgen.
4. Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung und ein Anspruch auf Kündigungsvergütung nach § 649 BGB werden - beruhend auf dem gleichen Werkvertrag - verjährungsrechtlich als selbstständig behandelt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0516
 Prozessuales
Prozessuales
VG München, Urteil vom 26.08.2024 - M 8 K 22.6303
1. Einzelne Sondereigentümer können gem. § 13 Abs. 1 Halbs. 2 WEG baurechtliche Nachbarrechte aus eigenem Recht geltend machen, wenn eine konkrete Beeinträchtigung ihres Sondereigentums im Raum steht. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot das Sondereigentum betrifft (wie VGH Bayern, ZWE 2013, 382 Rz. 5 f.).
2. Der einzelne Sondereigentümer kann baurechtliche Nachbarrechte nur insoweit geltend machen kann, als sein Sondereigentum konkret beeinträchtigt wird. Das ist nicht der Fall, wenn lediglich Rechte betroffen sind, die gem. § 9a Abs. 2 WEG einheitlich von der Wohnungseigentümergemeinschaft geltend gemacht werden, weil sie im Gemeinschaftseigentum wurzeln oder eine einheitliche Rechtsverfolgung erfordern. Dies umfasst die Geltendmachung öffentlich-rechtlicher Nachbaransprüche im Hinblick auf das Gemeinschaftseigentum (wie OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 06.10.2023 - 10 S 25.23, IMRRS 2023, 1366).
3. Auf den Gebietserhaltungsanspruch kann sich ein Sondereigentümer nicht berufen. Eine Verletzung dieses Anspruchs betrifft das einzelne Sondereigentum nicht stärker als das übrige Sonder- oder das Gemeinschaftseigentum. Der Gebietserhaltungsanspruch und der dadurch vermittelte Nachbarschutz beruhen auf dem Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses zwischen den Grundstückseigentümern in einem durch Bebauungsplan überplanten Gebiet oder einem faktischen Plangebiet nach § 34 Abs. 2 BauGB. Jeder Planbetroffene soll das Eindringen gebietsfremder Nutzungen und damit auch die schleichende Umwandlung des Gebiets verhindern können, auch ohne dass eine konkrete Beeinträchtigung besteht. Dieses nachbarliche Austauschverhältnis ist allein bezogen auf das konkrete Grundstück und löst daher eine Betroffenheit der Wohnungseigentümergemeinschaft als solcher aus, nicht aber eine Betroffenheit der einzelnen Sondereigentümer (wie VGH Bayern, ZWE 2013, 382 Rz. 7 f.).
 Volltext
Volltext