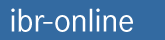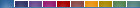Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
3493 Entscheidungen insgesamt
Online seit heute
IBRRS 2025, 0858 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
LG Berlin II, Urteil vom 18.02.2025 - 30 O 197/23
1. Ein Energieberater schuldet in der Regel zwar keinen Erfolg in Form der tatsächlichen Förderung, er schuldet aber eine fachlich zutreffende Beratung, aus der energetische Maßnahmen hervorgehen, die die Voraussetzungen der gesetzlichen Förderungsgrundlage erfüllen.
2. Der Energieberater verletzt seine vertragliche Beratungspflicht, wenn er für die einzuhaltenden Wärmedurchgangskoeffizienten (rechtsirrig) auf die Werte des GEG abstellt, obwohl für die Förderung die Werte des BEG EM maßgeblich sind.
 Volltext
Volltext
Online seit 27. März
IBRRS 2025, 0860 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Urteil vom 28.01.2025 - VI ZR 300/24
Bei fiktiver Schadensabrechnung ist der objektiv zur Herstellung erforderliche Betrag (§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB) ohne Bezug zu tatsächlich getätigten Aufwendungen zu ermitteln. Der Geschädigte ist nicht verpflichtet, zu den von ihm tatsächlich veranlassten oder auch nicht veranlassten Herstellungsmaßnahmen konkret vorzutragen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0859
 Immobilien
Immobilien
BGH, Beschluss vom 13.03.2025 - V ZR 59/24
1. Eine vereinbarte, aber nicht beurkundete Sanierungsverpflichtung macht den Kaufvertrag formunwirksam und verhindert die Entstehung der akzessorischen Auflassungsvormerkungen vor der Eintragung einer Zwangssicherungshypothek.
2. Die Zweifelsregel, wonach diejenige Auslegung vorzuziehen ist, die die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts vermeidet, findet keine Anwendung bei der Feststellung, ob überhaupt eine nicht beurkundete mündliche Vereinbarung getroffen wurde.
3. Die Nichtberücksichtigung eines erheblichen Beweisangebots, die im Prozessrecht keine Stütze findet, stellt einen Gehörsverstoß dar. Das gilt auch dann, wenn die Nichtberücksichtigung des Beweisangebots auf einer vorweggenommenen tatrichterlichen Beweiswürdigung beruht.
 Volltext
Volltext
Online seit 19. März
IBRRS 2025, 0749 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BAG, Urteil vom 30.01.2025 - 2 AZR 68/24
Die Vorlage des Einlieferungsbelegs eines Einwurf-Einschreibens und die Darstellung seines Sendungsverlaufs begründen ohne die Vorlage einer Reproduktion des Auslieferungsbelegs keinen Anscheinsbeweis für den Zugang beim Empfänger.
 Volltext
Volltext
Online seit 17. März
IBRRS 2025, 0715 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Urteil vom 20.02.2025 - VII ZR 133/24
1. Zur Frage rechtsmissbräuchlicher Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts gem. § 355 Abs. 1, § 312g Abs. 1 BGB (hier verneint).*)
2. Ein Ausschluss des Verbraucherwiderrufsrechts wegen Rechtsmissbrauchs kommt nur ausnahmsweise unter dem Gesichtspunkt besonderer Schutzbedürftigkeit des Unternehmers, etwa bei arglistigem Verhalten des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer, in Betracht.
3. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verneinung des Widerrufsrechts nicht vor, kann die darin liegende gesetzliche Wertung nicht durch den Rückgriff auf § 242 BGB umgangen werden. Es müssen dann vielmehr weitere Umstände hinzutreten, die den nur ausnahmsweise in Betracht kommenden Einwand des Rechtsmissbrauchs rechtfertigen können.
 Volltext
Volltext
Online seit 15. März
IBRRS 2025, 0648 Mietrecht
Mietrecht
LG Hamburg, Urteil vom 30.10.2024 - 316 S 38/24
1. Der Anspruch aus § 862 Abs. 1 BGB kann sich auch nur gegen eine erstmals ernsthaft drohende Störung richten (neuer Mietvertrag mit Dritten). Das Verhalten des Neu-Mieters muss sich der Vermieter zurechnen lassen.*)
2. Die einstweilige Verfügung zur Wahrung der Besitzschutzansprüche ist bis zur rechtskräftigen Verurteilung der Alt-Mieterin zur Räumung des Stellplatzes zu befristen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 14. März
IBRRS 2025, 0709 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Stuttgart, Urteil vom 11.03.2025 - 6 U 12/24
1. Aus Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs.3 EGBGB ergibt sich in richtlinienkonformer Auslegung der Vorschrift die Pflicht des Unternehmers, das Bestehen oder Nichtbestehen des Widerrufsrechts aus einem im Fernabsatz geschlossenen Verbrauchsgüterkauf eigenverantwortlich zu prüfen und den Verbraucher eindeutig darüber zu informieren. Diese Information ist dann nicht erteilt, wenn der Unternehmer den Verbraucher lediglich über die Voraussetzungen des Widerrufsrechts belehrt, ohne ihm konkret mitzuteilen, ob er zum Widerruf berechtigt ist.*)
2. Im Vergleich zu einer Widerrufsbelehrung, die dem Verbraucher eindeutig mitteilt, dass er zum Widerruf berechtigt ist, ist die abstrakte Belehrung lediglich über die rechtlichen Voraussetzungen eines Widerrufs [hier: „Wenn Sie ein Verbraucher sind und diesen Vertrag ausschließlich unter der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (wie z.B. über das Internet, per Telefon, E-Mail o.ä.) geschlossen haben,…“] weniger deutlich und stellt den Verbraucher vor nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Bestehens eines Widerrufsrechts. Er wird dadurch nicht in die Lage versetzt, sein Widerrufsrecht unter im Wesentlichen denselben Bedingungen wie bei Erteilung einer gesetzeskonformen Belehrung auszuüben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0639
 Gewerberaummiete
Gewerberaummiete
OLG Hamm, Beschluss vom 25.01.2025 - 7 U 47/24
1. Eine Rechtsscheinhaftung eines Geschäftsführers einer uG (haftungsbeschränkt) für eine Verbindlichkeit dieser haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft gemäß § 311 Abs. 2 und Abs. 3, § 179 (analog) BGB (in Anschluss an BGH, IBR 2022, 269; IBR 2012, 674; BGH, Urteil vom 05.02.2007 - II ZR 84/05, Rz. 9 ff., 17.02.2025 = NJW 2007, 1529) kommt im Hinblick auf eine allein deliktische Haftung der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft aus § 831 BGB oder aus § 823 BGB nicht in Betracht.*)
2. Der Vermieter ist nach den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter (zuletzt BGH, IMR 2024, 378) regelmäßig nicht - so auch hier - in den Schutzbereich des Untermietvertrags zwischen Mieter/Untervermieter und Untermieter einbezogen (in Fortschreibung zu BGH, Urteil vom 06.11.2012 - VI ZR 174/11, Rz. 9 m.w.N., IMRRS 2012, 3352 = NJW 2013, 1002; BGH, Urteil vom 02.07.1996 - X ZR 104/94, IBRRS 1996, 0041 = BGHZ 133, 168; BGH, Urteil vom 15.02.1978 - VIII ZR 47/77, BGHZ 70, 327 Ls. 1).*)
 Volltext
Volltext
Online seit 12. März
IBRRS 2025, 0636 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG München, Urteil vom 18.08.2023 - 173 C 11834/23
Selbst wenn aus der Wohnung eines Mieters Geräusche dringen, darf ein Nachbar nicht durch ständiges Klopfen hierauf reagieren. Vielmehr muss der Nachbar seinerseits gerichtlich gegen den anderen Mieter vorgehen und auf Unterlassung klagen.
 Volltext
Volltext
Online seit 5. März
IBRRS 2025, 0608 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
AG Hanau, Beschluss vom 03.03.2025 - 32 C 226/24
Die automatisierte Rückmeldung an den Absender einer E-Mail, die Adresse werde nicht mehr verwendet und die eingegangene E-Mail nicht weitergeleitet, steht dem Zugang der E-Mail nicht entgegen. Der Absender kann jedoch nebenvertraglich zur Verwendung eines anderen Kommunikationswegs verpflichtet sein.*)
Online seit 3. März
IBRRS 2025, 0591 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
BGH, Beschluss vom 25.02.2025 - VIII ZR 143/24
Zur Frage, ob dem Verbraucher beim Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer von der Musterwiderrufsbelehrung in Teilen abweichenden Widerrufsbelehrung zusätzlich eine (hier auf der Internet-Seite des Unternehmers zugängliche) Telefonnummer des Unternehmers mitgeteilt werden muss, wenn in der Widerrufsbelehrung als Kommunikationsmittel beispielhaft dessen Postanschrift und E-Mail-Adresse genannt werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2025, 0566
 Mietrecht
Mietrecht
AG Köln, Urteil vom 19.08.2024 - 148 C 34/24
ohne amtlichen Leitsatz
 Volltext
Volltext
Online seit 2. März
IBRRS 2025, 0515 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
AG Brandenburg, Urteil vom 05.12.2024 - 30 C 190/22
1. Der für eine (Video-)Kamera Verantwortliche muss nachweisen, dass die Verarbeitung der Videoaufnahmen den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entspricht, so dass eine betroffene Person nicht nachweisen muss, dass der Verantwortliche nicht rechtmäßig gehandelt hat. Aus diesem Grunde trifft den Kläger auch nicht die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich eines rechtswidrigen Eingriffs durch den für die (Video-)Kamera verantwortlichen Beklagten (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 12, § 253, § 823 Abs. 1, § 862 und § 1004 Abs. 1 BGB unter Beachtung von Artikel 5 Abs. 2 und Artikel 24 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung sowie § 4, § 6 und § 6b Bundesdatenschutzgesetz und § 201a StGB).
2. Das Recht am eigenen Bild begründet einen Anspruch auf Unterlassung von möglichen Videoaufnahmen, wenn nicht überwiegende Interessen die Videoüberwachung rechtfertigen.
3. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schützt nicht nur vor tatsächlicher Bild- und Tonaufzeichnung, sondern erfasst schon die berechtigte Befürchtung einer Aufzeichnung.
4. Der Verantwortliche trägt auch die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Überwachung sich auf das eigene Grundstück beschränkt und durch einfache technische Änderungen nicht darüber hinaus erweitert werden kann.
 Volltext
Volltext
Online seit 27. Februar
IBRRS 2025, 0551 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Zweibrücken, Urteil vom 15.01.2025 - 1 U 20/24
Werden dem Ehemann Zugangsdaten für den eigenen E-Mail-Account zugänglich gemacht und wird dieser Zugang von ihm über längere Zeit hinweg und in Kenntnis seiner Ehefrau unter deren Namen rechtsgeschäftlich genutzt, kann eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht anzunehmen sein, demnach der Ehefrau das Handeln ihres Ehemannes zuzurechnen ist.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 12. Februar
IBRRS 2025, 0400 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG München, Urteil vom 08.01.2025 - 7 U 1776/23
1. Voraussetzung für einen Vertragsschluss nach den Grundsätzen über das kaufmännische Bestätigungsschreiben sind u.a. Verhandlungen, die auch per WhatsApp geführt werden können.
2. Eine Rechnung, in der vorangegangene Verhandlungen und Abreden per WhatsApp zusammengefasst werden, kann ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben darstellen.
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden durch die Inbezugnahme in einem kaufmännischen Bestätigungsschreiben Vertragsbestandteil.
 Volltext
Volltext
Online seit 10. Februar
IBRRS 2025, 0364 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
EuGH, Urteil vom 06.02.2025 - Rs. C-677/22
1. Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie 2011/7/EU (...) ist dahin auszulegen, dass die Wendung "im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart" einer Vertragsklausel entgegensteht, die eine vom Schuldner einseitig festgelegte Zahlungsfrist von mehr als 60 Kalendertagen vorgibt, es sei denn, es kann unter Berücksichtigung aller Vertragsunterlagen und Klauseln in diesem Vertrag festgestellt werden, dass die Vertragsparteien ihren übereinstimmenden Willen zum Ausdruck gebracht haben, gerade durch die betreffende Klausel gebunden zu sein.*)
2. Das Erfordernis einer ausdrücklichen Vereinbarung bedeutet, dass unter Berücksichtigung aller Vertragsunterlagen und der darin enthaltenen Klauseln nachgewiesen werden kann, dass die Vertragsparteien ihren übereinstimmenden Willen zum Ausdruck gebracht haben, gerade durch die Klausel, die eine von der in dieser Bestimmung vorgesehenen Frist von 60 Kalendertagen abweichende Zahlungshöchstfrist festlegt, gebunden zu sein.
3. Diesem Erfordernis kann auch im Rahmen eines vorformulierten Standardvertrags Genüge getan werden, wenn eine dieser Parteien die betreffende Klausel in den Vertragsunterlagen hervorgehoben hat, um sie klar von den anderen Klauseln des Vertrags zu unterscheiden und damit ihren Ausnahmecharakter zum Ausdruck zu bringen und um es der anderen Partei somit zu ermöglichen, ihr in voller Kenntnis der Sachlage zuzustimmen.
 Volltext
Volltext
Online seit 3. Februar
IBRRS 2025, 0285 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Beschluss vom 10.12.2024 - VI ZR 323/23
1. Zur Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch Übergehen von Vortrag zu einem übereinstimmenden Verständnis eines Vorbehalts in einer Abfindungsvereinbarung.*)
2. Haben die Parteien eines Vertrages eine Willenserklärung übereinstimmend in einem bestimmten Sinne verstanden, ist für den Inhalt der Erklärung der übereinstimmende Parteiwille maßgebend. Dieser geht nicht nur dem Wortlaut, sondern jeder anderweitigen Interpretation vor.
3. Wird der tatsächliche Wille des Erklärenden bei Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung bewiesen oder sogar zugestanden und hat der andere Teil sie ebenfalls in diesem Sinne verstanden, dann bestimmt dieser Wille den Inhalt des Rechtsgeschäfts, ohne dass es auf weiteres ankommt.
 Volltext
Volltext
Online seit 30. Januar
IBRRS 2025, 0265 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LAG Hamm, Urteil vom 15.11.2024 - 1 SLa 733/24
Mit einem Vergleich i.S.d. § 779 BGB wollen die Parteien Ungewissheiten beilegen, nicht angenommenen Gewissheiten eine neue Rechtsqualität geben. Gehen die Parteien wie selbstverständlich vom Bestand einer Anspruchsgrundlage aus und wollen sie lediglich eine Verständigung über die Höhe des geschuldeten Betrags herbeiführen, führt die Unwirksamkeit der den vermeintlichen Anspruch begründenden Klausel zur Unwirksamkeit des Vergleichs, weil ein als feststehend angenommener Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden wäre.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 24. Januar
IBRRS 2025, 0186 Prozessuales
Prozessuales
OLG München, Beschluss vom 06.12.2024 - 11 W 1793/24
1. Auch wenn der Rechtspfleger grundsätzlich an die Kostengrundentscheidung gebunden ist, ist er gehalten, bei darin enthaltenen Unklarheiten eine Auslegung vorzunehmen.
2. Das Kostenfestsetzungsverfahren hat nur den Zweck, die Kostengrundentscheidung der Höhe nach zu beziffern und ist deshalb auf eine formale Prüfung der Kostentatbestände ausgelegt, nicht aber auf die Klärung komplizierter materiell-rechtlicher Fragen (hier: Abgeltung der Sachverständigenkosten durch einen Prozessvergleich).
3. Ergibt die Auslegung kein klares Ergebnis, geht das zulasten desjenigen, der die Glaubhaftmachungslast trägt.
4. Sachverständigenkosten sind mangels Prozessbezogenheit keine Kosten des Rechtsstreits, wenn die Heranziehung des Sachverständigen auf Streitvermeidung gerichtet war.
 Volltext
Volltext
Online seit 21. Januar
IBRRS 2025, 0144 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Zweibrücken, Urteil vom 30.11.2023 - 4 U 152/22
1. Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll, bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Dies gilt nicht für Verpflichtungserklärungen in Geschäften der laufenden Verwaltung, die für die Gemeinde finanziell unerheblich sind.
2. Ein Mangel der vorgegebenen Form und Vertretung führt zur schwebenden Unwirksamkeit des betreffenden Rechtsgeschäfts. Die Bestimmungen über die Art und Weise der Abgabe von privatrechtlichen Verpflichtungserklärungen sind als in der landesrechtlichen Gesetzgebungskompetenz liegende Beschränkungen der Vertretungsmacht anzusehen.
3. Bei zweiseitigen Rechtsgeschäften kann das vollmachtlose Handeln für eine Gemeinde wie jedes vollmachtlose Handeln für einen sonstigen Dritten durch ordnungsmäßige Genehmigung des berechtigten Dritten rückwirkend verbindlich werden.
4. Soweit der Form- oder Vertretungsmangel bei einseitigen Rechtsgeschäften an sich zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führen müsste, ist in weitem Umfang eine Heilung durch nachträgliche Genehmigung bzw. Nachholung der unterlassenden Form möglich.
 Volltext
Volltext
Online seit 20. Januar
IBRRS 2025, 0158 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 30.10.2024 - 17 U 170/23
1. Ein Vorvertrag muss ein solches Maß an Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit und Vollständigkeit enthalten, dass im Streitfall der Inhalt des Hauptvertrages, auf dessen Abschluss der Vorvertrag gerichtet ist, richterlich festgestellt werden kann, notfalls durch eine richterliche Vertragsergänzung. Ausreichend ist in jedem Fall die Einigung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii) des späteren Hauptvertrags. Die Ausgestaltung näherer Vertragsbedingungen kann den weiteren Verhandlungen, die zum Abschluss des Hauptvertrages führen sollen, vorbehalten bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.1992 - XII ZR 173/90, IBRRS 1992, 0632; BGH, Urteil vom 20.09.1989 - VIII ZR 143/88, IBRRS 1989, 0232).*)
2. Werden sich die Parteien des Vorvertrags im Zuge ihrer auf Abschluss des Hauptvertrags gerichteten Verhandlungen über weitere Einzelheiten einig, handelt es sich regelmäßig um Schritte zur inhaltlichen Ausgestaltung des angestrebten Hauptvertrages, denen bis zum Abschluss des Hauptvertrags keine bindende Wirkung zukommt und von denen sich die Parteien auch wieder lösen können, ohne die Bindungswirkung des Vorvertrages in Frage zu stellen.
3. Die Verhandlung über die inhaltliche Ausgestaltung des Hauptvertrags führt deshalb regelmäßig nicht zu einer Änderung des Vorvertrags. Zwar ist es denkbar, dass die Parteien im Zuge ihrer Verhandlungen über den Hauptvertrag auch den Vorvertrag abändern. Für eine Erweiterung oder Einschränkung des maßgeblichen Bindungswillens sind aber hinreichende Anhaltspunkte erforderlich. Die bloße Einigung über einzelne Konditionen des künftigen Hauptvertrags genügt dafür nicht, auch wenn der Vorvertrag insoweit andere Regelungen enthält.
 Volltext
Volltext
Online seit 17. Januar
IBRRS 2025, 0143 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 19.12.2024 - 10 U 201/22
1. Zur Unzulässigkeit einer Teilwiderklage bei mehreren Streitgegenständen ohne hinreichende Zuordnung.*)
2. Zur Abgrenzung Werkvertrag/Dienstvertrag beim Software-Vertrag.*)
3. Zum Schadensersatzanspruch bei völlig unbrauchbarer Leistung.*)
4. Kostenentscheidung zu Lasten der berufungsführenden Streithelferin bei fehlender Beteiligung der unterstützten Partei trotz deren Anwesenheit in der Videoverhandlung.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2. Januar
IBRRS 2025, 0013 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.09.2024 - 5 W 3/24
1. Der Messstellenbetreiberrahmenvertrag (MSB-RV) kann nach § 14 Abs. 2 MSB-RV nur dann fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn gegen wesentliche Bestimmungen des Vertrags wiederholt trotz Abmahnung schwer wiegend verstoßen wird. An einen solchen Verstoß sind keine zu geringen Anforderungen zu stellen, da die grundzuständigen Messstellenbetreiber ansonsten den vom Gesetzgeber gewünschten Wettbewerb unterlaufen könnten.*)
2. Nach allgemeinen Regeln trägt der Kündigende auch im Rahmen des MSB-RV die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsachen, aus denen sich der wichtige Grund ergibt, auf den er sein Kündigungsrecht stützt.*)
3. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines wichtigen Grunds i.S.v. § 14 Abs. 2 MSB-RV, § 314 Abs. 2 BGB, ist derjenige der Kündigung.*)
4. Leidet die auf Grundlage der Abmahnung bewirkte Leistung an einem anderen Defizit als demjenigen, für das der Gläubiger die Abmahnung ausgesprochen hatte und das daraufhin beseitigt wurde, ist eine neue Abmahnung auszusprechen.*)
5. Die Kündigung bedarf keiner Begründung, so dass ein Nachschieben von Umständen, die im Zeitpunkt der Ausübung des Kündigungsrechts aus wichtigem Grund bereits bestanden, auch im Rechtsstreit noch möglich ist.*)
6. Voraussetzung dafür, dass der Kündigende sich auf solche nachgeschobenen Gründe berufen kann, ist, dass die Kündigungsgründe nicht ausgeschlossen sind und objektiv zur Zeit der Kündigung diese rechtfertigen. Durch das Nachschieben der Gründe werden nicht die weiteren Voraussetzungen von § 14 Abs. 2 MSB-RV, § 314 Abs. 2 BGB entbehrlich, so dass der nachgeschobene Grund die Kündigung nur dann rechtfertigen kann, wenn dieser entweder bereits Gegenstand einer Abmahnung war oder aber eine solche ausnahmsweise entbehrlich war.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 23. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3672 Werkvertrag
Werkvertrag
AG Hannover, Urteil vom 14.07.2023 - 539 C 1401/23
(Ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
Online seit 3. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3508 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
EuGH, Urteil vom 25.01.2024 - Rs. C-810/21
1. Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG (...) über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen sind (...) dahin auszulegen, dass sie einer gerichtlichen Auslegung des nationalen Rechts entgegenstehen, wonach im Anschluss an die Nichtigerklärung einer missbräuchlichen Vertragsklausel, mit der dem Verbraucher die Kosten des Abschlusses eines Hypothekendarlehensvertrags auferlegt werden, der Anspruch auf Erstattung solcher Kosten einer Verjährungsfrist von zehn Jahren unterliegt, die ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu dem sich die Wirkungen dieser Klausel erschöpft haben, weil die letzte Zahlung der Kosten geleistet wurde, ohne dass es insoweit als relevant angesehen würde, dass der Verbraucher von der rechtlichen Würdigung dieses Sachverhalts Kenntnis hat. Ob die Anwendungsmodalitäten einer Verjährungsfrist mit den oben genannten Bestimmungen vereinbar sind, ist unter Berücksichtigung dieser Modalitäten in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.*)
2. Die Richtlinie 93/13 ist dahin auszulegen, dass sie einer gerichtlichen Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach zur Bestimmung des Beginns der Verjährungsfrist für den Anspruch des Verbrauchers auf Erstattung von aufgrund einer missbräuchlichen Vertragsklausel rechtsgrundlos gezahlten Beträgen das Bestehen einer gefestigten nationalen Rechtsprechung zur Nichtigkeit derartiger Klauseln als Nachweis dafür angesehen werden kann, dass die Voraussetzung der Kenntnis des betroffenen Verbrauchers von der Missbräuchlichkeit dieser Klausel und den sich daraus ergebenden Rechtsfolgen erfüllt ist.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2024
IBRRS 2024, 3454 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LG Lübeck, Urteil vom 17.10.2024 - 5 O 125/23
(Ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3412
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG München, Urteil vom 11.11.2024 - 19 U 200/24
1. Textnachrichten oder Attachments in Gestalt von Textverarbeitungs- oder PDF-Dateien oder ausreichend guter Fotos per WhatsApp wahren bei rechtsgeschäftlich vereinbarter Schriftform die Voraussetzungen des § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB. Dies gilt nicht bei WhatsApp-Sprachnachrichten oder Video- oder Audio-Attachments.*)
2. Eine Willenserklärung kann auch mittels Zeichen kundgetan werden, d.h. auch durch digitale Piktogramme - wie Emojis. Ob der Verwender von Emojis einen Rechtsbindungswillen zum Ausdruck bringen oder lediglich seine Stimmungs- oder Gefühlslage mitteilen möchte, ist eine Frage der Auslegung.*)
3. Faktoren wie Nationalität und Muttersprache, kultureller Hintergrund sowie Alter, Geschlecht oder Persönlichkeitsstruktur können sowohl die Nutzung als auch das Verständnis von Emojis beeinflussen.*)
4. Emojis bergen die Gefahr von Missverständnissen und Fehlschlüssen, weil die konkret verwendeten Symbole möglicherweise auf einem spezifischen "Emoji-Soziolekt" beruhen, der bloß innerhalb einer bestimmten Gruppe existiert.*)
5. Zu Bestimmung des Bedeutungsgehalts von Emojis kann der Rechtsanwender gegebenenfalls Emoji-Lexika zurate ziehen. Hinweise auf das Verständnis eines Emojis können auch aus dem Begleittext folgen.*)
IBRRS 2024, 3321
 Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht
OLG Nürnberg, Urteil vom 18.06.2024 - 6 U 2481/22
Der fensterrechtliche Anspruch gemäß Art. 43 BayAGBGB kann eingeschränkt werden, wenn sich seine Geltendmachung nach den konkreten Umständen als treuwidrig gemäß § 242 BGB darstellt. (Rn. 68 - 69 und 74)*)
1. Die uneingeschränkte Ausübung des Fensterrechts durch den Gläubiger kann treuwidrig sein, wenn die Ausübung für für den verpflichteten Nachbarn eine extreme Härte darstellt, sie dessen Wohnung offenkundig stark entwertet und die Ausübung damit an einen enteignungsgleichen Eingriff grenzt. (Rn. 75)*)
2. Ausnahmen von dem in Art. 43 BayAGBGB normierten Verbot, Fenster entlang der Grundstücksgrenze einzubauen, können sich aus der Notwendigkeit von Fenstern und Türen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. (Rn. 64)*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3236
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LG Kiel, Urteil vom 17.10.2024 - 6 O 109/24
1. Ein Vertrag über die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen ist kein Werk-, sondern ein Dienstvertrag, wenn der Dienstverpflichtete keinen Erfolg, sondern (nur) eine Tätigkeit, nämlich die Überwachung eines Objekts vor Ort schuldet.
2. Eine Schlechtleistung des Dienstverpflichteten führt regelmäßig nicht zum Ausschluss des Vergütungsanspruchs. Das gesetzliche Dienstvertragsrecht kennt kein Recht zur Minderung.
3. Durch das Fehlen eines Minderungsrechts im Fall der Schlechtleistung wird der Dienstberechtigte nicht schutzlos gestellt. Entsteht ihm durch eine Schlechtleistung des Dienstverpflichteten ein Schaden, bleibt es ihm unbenommen, mit einem entsprechenden Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB gegen den Vergütungsanspruch des Dienstverpflichteten aufzurechnen.
4. Zudem steht dem Dienstberechtigten ein auf Befreiung von der Vergütungspflicht gerichteter Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB zu, wenn die erbrachten Dienste für ihn infolge einer von dem Dienstverpflichteten zu vertretenden Schlechtleistung ohne Interesse und völlig unbrauchbar sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3208
 Prozessuales
Prozessuales
OLG Köln, Urteil vom 27.08.2024 - 4 U 54/23
1. Verpflichtet sich eine Partei wirksam zur Klagerücknahme, kommt sie aber der Verpflichtung nicht nach, kann ihr dies vom Prozessgegner mit der Folge entgegengehalten werden, dass die Fortsetzung des Prozesses unzulässig wird.
2. Ein Dritter (hier: Vertragsgegner) kann sich auf die Unbeschränkbarkeit der Vertretungsmacht dann nicht berufen, wenn der Vertreter bewusst zum Nachteil des Vertretenen gehandelt hat und dies dem Dritten schuldhafterweise nicht bekannt geworden ist.
3. Eine Quittung erbringt einen vollen Beweis dafür, dass die in ihr enthaltene Erklärung von dem Unterzeichner abgegeben worden ist, nicht aber für den Inhalt der Erklärung, also die Erfüllung der Verbindlichkeit; insoweit unterliegt sie der freien richterlichen Beweiswürdigung. Sie enthält ein außergerichtliches Geständnis hinsichtlich des Leistungsempfangs, ein Zeugnis des Gläubigers "gegen sich selbst", und dementsprechend in der Regel auch ein Indiz für die Leistung (Erfüllung) des Schuldners.
4. Dieser eingeschränkte "Beweiswert" einer Quittung kann jedoch dadurch entkräftet werden, dass die Überzeugung des Gerichts vom Empfang der Leistung erschüttert wird; ein voller "Gegenbeweis" im Sinne des Nachweises der inhaltlichen Unwahrheit der Quittung ist nicht nötig, wobei es tragfähiger Anhaltspunkte bedarf, die den Verdacht der inhaltlichen Unrichtigkeit der Quittung ernstlich nahelegen.
5. Die Nichterteilung einer den Anforderungen des § 14 Abs. 1 UStG entsprechenden Rechnung begründet ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB, das lediglich ex nunc wirkt und die Verzugswirkungen nicht rückwirkend entfallen lässt. Vielmehr kann dieses einen Verzugseintritt nur verhindern, wenn es vor oder bei Fälligkeit der Forderung ausgeübt wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3168
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG München, Urteil vom 16.09.2024 - 7 U 1412/23 e
1. Ist in Ermangelung einer ausdrücklichen Erklärung ungewiss, ob der Vertreter den Vertrag in fremdem Namen abschloss, ist die Willenserklärung des Vertreters gemäß §§ 133, 157 BGB unter Berücksichtigung aller Umstände auszulegen. Von Bedeutung ist also, wie sich die Erklärung nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte für einen objektiven Betrachter in der Lage des Erklärungsgegners darstellt. Dabei sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, insbesondere die dem Rechtsverhältnis zugrundeliegenden Lebensverhältnisse, die Interessenlage, der Geschäftsbereich, dem der Erklärungsgegenstand zugehört und die typischen Verhaltensweisen.
2. Bei der Auslegung einer Willenserklärung sind aber nur solche Umstände zu berücksichtigen, die dem Empfänger bei Zugang der Willenserklärung erkennbar waren. Aus Umständen, die erst nach Zugang der Erklärung zu Tage treten, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass der Empfänger diese Erklärung in einem anderen als in dem zum Zeitpunkt des Zugangs erkennbaren Sinn verstehen musste.
3. Das nachträgliche Verhalten einer Partei kann nur in dem Sinne berücksichtigt werden, dass spätere Vorgänge Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen und das tatsächliche Verständnis der am Rechtsgeschäft Beteiligten zulassen können.
4. Die Unklarheitenregelung des § 305c Abs. 2 BGB greift nicht, wenn es um die Frage geht, ob und gegebenenfalls für wen eine Willenserklärung abgegeben worden sein soll. Dies hat durch eine subjektive Auslegung nach §§ 133, 157 BGB zu erfolgen. Selbst wenn nach vorgenommener Auslegung zweifelhaft bliebe, ob ein Fremd- oder ein Eigengeschäft vorliegt, wäre gemäß § 164 Abs. 2 BGB ein Eigengeschäft anzunehmen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3167
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Bremen, Urteil vom 16.10.2024 - 1 U 18/24
1. Das Bestehen eines Auskunftsanspruchs hinsichtlich des Umfangs des erlangten Ersatzes als Mittel der Aufklärung zur Geltendmachung eines Anspruchs aus § 285 BGB setzt voraus, dass der Auskunftsfordernde die weiteren Voraussetzungen eines solchen Anspruchs auf Herausgabe des stellvertretenden commodums - abgesehen von der Höhe des erlangten Ersatzes an sich - darlegen und gegebenenfalls beweisen kann.*)
2. Die Vorschrift des § 285 BGB ist anwendbar auch auf Rückgewähransprüche im Rückabwicklungsverhältnis nach § 346 BGB.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3156
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.10.2024 - 12 U 108/21
1. Die nach objektiven Maßstäben zu bestimmende Annahmefrist gemäß § 147 Abs. 2 BGB setzt sich zusammen aus der Zeit für die Übermittlung des Antrages an den Empfänger, dessen Bearbeitungs- und Überlegungszeit sowie der Zeit der Übermittlung der Antwort an den Antragenden. Sie beginnt daher schon mit der Abgabe der Erklärung und nicht erst mit deren Zugang bei dem Empfänger.
2. Die Überlegungsfrist bestimmt sich vor allem nach der Art des Angebots. Nach seinem Inhalt ist zu beurteilen, ob der Antragende die Behandlung des Angebots als eilbedürftig erwarten darf. Dazu gehören auch verzögernde Umstände, die der Antragende kannte oder kennen musste. Als solche kommen etwa die Organisationsstruktur großer Unternehmen, die Erfordernisse der internen Willensbildung bei Gesellschaften oder juristischen Personen oder auch absehbare Urlaubszeiten in Betracht, sofern von einem verzögernden Einfluss auf die Bearbeitungsdauer auszugehen ist.
3. Zu beweisen hat das Zustandekommen des Vertrags und damit auch die Rechtzeitigkeit der Annahme grundsätzlich derjenige, der den Vertragsschluss behauptet und daraus Rechtsfolgen ableitet. Beruft sich der das Vertragsangebot Annehmende darauf, dass der Vertrag wirksam sei, hat er mithin darzulegen und zu beweisen, dass seine Annahmeerklärung rechtzeitig zugegangen ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3117
 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 12 U 114/23
Für die Annahme eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags müssen sowohl Angebot als auch Annahme bei gleichzeitiger Anwesenheit der Vertragspartner erklärt werden. Es ist nicht ausreichend, wenn vor Ort in Anwesenheit beider Parteien lediglich ein zuvor abgegebenes Angebot des Auftragnehmers angenommen wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3116
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 10.10.2024 - 12 U 185/23
1. Für einen Fernabsatzvertrag muss zunächst ein Vertragsschluss ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln erfolgt sein. Das ist nicht gegeben, wenn während der Vertragsanbahnung Verhandlungen im Rahmen von persönlichen Kontakten zwischen den Parteien selbst oder ihren Vertretern stattgefunden haben.
2. Andererseits ist ein Fernabsatzvertrag dann nicht ausgeschlossen, wenn sich der Verbraucher etwa in Geschäftsräumen des Unternehmers lediglich über die Ware oder die Dienstleistung informiert hat und anschließend den Vertrag aus der Ferne verhandelt und abschließt.
3. Zwar hat grundsätzlich der Verbraucher die Voraussetzung des ihm günstigen § 312c Absatz 1 BGB zu beweisen, allerdings kehrt sich die Beweislast um, wenn der Verbraucher nachweist, dass der Vertragsschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln erfolgt ist; es obliegt dann dem Unternehmer zu beweisen, dass es bereits zuvor zu wesentlichen Vertragsverhandlungen gekommen ist.
4. Beim Vertragsschluss mit einer natürlichen Person ist grundsätzlich von einem Verbraucherhandeln durch diese auszugehen, sodass eine abweichende Einordnung nur dann in Betracht kommt, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig und zweifelsfrei darauf hinweisen, dass die natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
5. Auch wenn der Verbraucher grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür trägt, dass nach dem von ihm objektiv verfolgten Zweck ein seinem privaten Rechtskreis zuzuordnendes Rechtsgeschäft vorliegt, gehen Unsicherheiten und Zweifel aufgrund der äußeren, für den Vertragspartner erkennbaren Umstände des Geschäfts nach der negativen Formulierung in § 13 BGB nicht zulasten des Verbrauchers.
6. Für ein organisiertes Vertriebssystem muss der Unternehmer durch personelle und sachliche Ausstattung innerhalb seines Betriebs die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen haben, die notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatz zu tätigende Geschäfte zu bewältigen. Daran sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Nur Geschäfte, die unter gelegentlichem, eher zufälligem Einsatz von Fernkommunikationsmitteln geschlossen werden, sollen aus dem Anwendungsbereich ausscheiden. Auch trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, dass eine entsprechende Organisation bei ihm nicht gegeben ist.
7. Für einen wirksamen Widerruf ist nicht erforderlich, dass das Wort "Widerruf" verwendet wird; vielmehr genügt es, wenn der Erklärende deutlich zum Ausdruck bringt, er wolle den Vertrag von Anfang an nicht gelten lassen, weshalb die Umstände des Einzelfalls ergeben können, dass die Erklärung eines "Rücktritts" als Widerruf auszulegen ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3118
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Hamm, Urteil vom 13.11.2023 - 2 U 168/22
1. Bei der Anscheinsvollmacht kann sich der Vertretene auf den Mangel der Vertretungsmacht seines Vertreters nicht berufen, wenn er schuldhaft den Rechtsschein einer Vollmacht veranlasst hat, so dass der Geschäftsgegner von einer Bevollmächtigung ausgehen darf und von ihr ausgegangen ist.
2. Das kommt in Betracht, wenn er nach Lage der Dinge ohne Fahrlässigkeit annehmen darf, der Vertretene kenne und dulde das Verhalten des für ihn auftretenden Vertreters. Dieser Rechtsgrundsatz greift aber nur dann ein, wenn das Verhalten des einen Teils, aus dem der Geschäftsgegner auf die Bevollmächtigung eines Dritten schließen zu können glaubt, von einer gewissen Häufigkeit und Dauer ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3097
 Nachbarrecht
Nachbarrecht
OLG Stuttgart, Urteil vom 13.03.2024 - 3 U 49/23
1. Besteht zwischen Nachbarn Mitbesitz im Sinne des § 866 BGB an einem Grundstücksgrenzen überschreitenden Entwässerungsrohrsystem, bilden die Mitbesitzer eine Bruchteilsgemeinschaft im Sinne des § 741 BGB.*)
2. Maßgebliches Kriterium für die Feststellung unmittelbaren Besitzes im Sinne des § 854 Abs. 1 BGB an einem Entwässerungsrohrsystem kann sein, von wem die Abwasserleitung tatsächlich genutzt wird.*)
3. Das Recht zur Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft kann gemäß § 242 BGB wegen der Grundsätze des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses ausgeschlossen sein.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3005
 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
OLG Stuttgart, Beschluss vom 18.07.2024 - 6 U 34/24
1. Unternehmer- und nicht Verbraucherhandeln vor, wenn das fragliche Geschäft nach seiner objektiven Zweckrichtung zur Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit (sog. Existenzgründung) geschlossen wird.
2. Ein Vertrag ist als Verbrauchervertrag zu qualifizieren, wenn er darauf gerichtet ist, dem Kunden erst die für die Entscheidung zur Existenzgründung erforderliche Sachkunde zu verschaffen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3004
 Verbraucherrecht
Verbraucherrecht
OLG Stuttgart, Beschluss vom 30.09.2024 - 6 U 34/24
1. Unternehmer- und nicht Verbraucherhandeln vor, wenn das fragliche Geschäft nach seiner objektiven Zweckrichtung zur Aufnahme einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit (sog. Existenzgründung) geschlossen wird.
2. Ein Vertrag ist als Verbrauchervertrag zu qualifizieren, wenn er darauf gerichtet ist, dem Kunden erst die für die Entscheidung zur Existenzgründung erforderliche Sachkunde zu verschaffen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2915
 Immobilien
Immobilien
OLG Hamm, Urteil vom 07.03.2024 - 22 U 86/23
1. Ist in einem notariellen Grundstückskaufvertrag die Lastenfreiheit des Kaufobjekts eine Fälligkeitsvoraussetzung für die Kaufpreisforderung und ist der Käufer vorleistungspflichtig, so hat der Käufer vorbehaltlich einer abweichenden besonderen Vertragsausgestaltung keinen verzugsbegründenden Anspruch gegen den Verkäufer auf Herbeiführung der Lastenfreiheit.*)
2. § 321 BGB ist entsprechend anzuwenden, wenn die Leistung des vorleistungspflichtigen Käufers (mangels Sicherstellung der Lastenfreiheit) noch nicht fällig ist und nach dem Kaufvertragsabschluss bekannt wird, dass der Verkäufer die Lastenfreiheit auf absehbare Zeit nicht gewährleisten kann. Der Käufer hat in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 321 Abs. 2 BGB die Möglichkeit, vom Kaufvertrag zurückzutreten.*)
3. Wenn § 321 BGB einschlägig ist, dürfen die hieraus resultierenden Rechtsfolgen nicht durch einen Schadensersatzanspruch aufgrund der Verletzung der sog. vertraglichen Leistungstreuepflicht (der Verpflichtung, den Vertragszweck und den Leistungserfolg weder zu gefährden noch zu beeinträchtigen) konterkariert werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2000
 Amtshaftung
Amtshaftung
BGH, Urteil vom 11.04.2024 - III ZR 134/22
1. Die infektionsschutzrechtliche Generalklausel des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG und die Verordnungsermächtigung in § 32 Satz 1 IfSG waren bis zum 18.11.2020 eine verfassungsgemäße Grundlage für die durch Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie angeordneten Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschließungen. Insbesondere genügten sie den aus Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG sowie aus Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG folgenden Anforderungen an die Bestimmtheit einer gesetzlichen Regelung.*)
2. Ab dem 19.11.2020 wurde die Generalklausel des § 28 Abs. 1 IfSG in § 28a Abs. 1 IfSG durch die Benennung nicht abschließender Regelbeispiele auf verfassungsgemäße Weise konkretisiert.*)
3. Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschließungen konnten insbesondere zu Beginn der COVID-19-Pandemie im Wege von Allgemeinverfügungen angeordnet werden.*)
4. Zur Verhältnismäßigkeit infektionsschutzrechtlicher Beherbergungs- und Veranstaltungsverbote sowie Gaststättenschließungen (hier: Hotelkonzern) in dem Zeitraum von März 2020 bis Juni 2021 zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus ("erster und zweiter Lockdown").*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2825
 Immobilien
Immobilien
OLG Hamm, Beschluss vom 29.02.2024 - 7 U 72/22
1. Es besteht im Ruhrgebiet weiterhin (trotz oder gerade wegen des Klimawandels) keine dahingehende allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Schneefanggitter auf Dächern von Gebäuden anzubringen (im Anschluss an OLG Hamm, Beschluss vom 01.02.2023 - 11 U 67/22; OLG Hamm, Beschluss vom 14.08.2012 - 9 U 119/12, IBRRS 2013, 0572 = IMRRS 2013, 0414 = NJW-RR 2013, 25; OLG Hamm Beschluss vom 07.02.2012 - 7 U 87/11).*)
2. Auch für das Aufstellen von Warnschildern vor Schneeabgängen besteht kein Anlass, wenn die Gefahrumstände für jedermann wie für den Geschädigte aufgrund der wahrnehmbaren Ausnahmesituation ohne Weiteres ersichtlich sind (im Anschluss an OLG Hamm, Beschluss vom 01.02.2023 - 11 U 67/22, BeckRS 2023, 45655; OLG Hamm, Beschluss vom 14.08.2012 - 9 U 119/12, IBRRS 2013, 0572 = IMRRS 2013, 0414 = NJW-RR 2013, 25; OLG Hamm, Beschluss vom 07.02.2012 - 7 U 87/11).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2823
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
KG, Beschluss vom 09.07.2024 - 1 W 27/24
Werden in einer öffentlichen Verfügung von Todes wegen namentlich nicht bezeichnete Kinder als Erben bestimmt, kann das Grundbuchamt gemäß § 35 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 GBO die Vorlage eines Erbscheins (oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses) verlangen. Geburtsurkunden in Verbindung mit einer Versicherung an Eides statt, es seien keine weiteren Kinder geboren worden, genügen für den Nachweis der Erbfolge nicht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2737
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LG Köln, Urteil vom 16.05.2024 - 14 O 308/22
1. Ein Vertragsschluss nach den Grundsätzen über das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben setzt voraus, dass die Parteien in geschäftlichem Kontakt stehen, eine Partei einen vorangegangenen Vertragsschluss bestätigen will oder eine mündliche Vereinbarung erst durch das Bestätigungsschreiben Gültigkeit haben soll und das Bestätigungsschreiben in engem zeitlichen Zusammenhang zu dem Vertragsschluss bzw. den Vertragsverhandlungen abgesandt wird.
2. Ein Zeitraum von fast zwei Monaten zwischen dem Vertragsschluss bzw. den Vertragsverhandlungen und dem Bestätigungsschreiben fehlt es an einem engen zeitlichen Zusammenhang. Bei einem solchen Zeitintervall kann dem Schweigen des (möglichen) Vertragspartners kein Erklärungswert beigemessen werden. Ein Angebot nach einer entsprechend langen Zeit erfordert vielmehr eine ausdrückliche oder konkludente Annahme durch den Vertragspartner.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2712
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Celle, Urteil vom 31.07.2024 - 14 U 104/23
1. Nach dem Zweck des § 531 Abs. 2 ZPO soll der entscheidungsrelevante Sach- und Streitstoff bereits in erster Instanz vollständig unterbreitet werden. Mit dieser Zweckbestimmung wäre es grundsätzlich nicht vereinbar, das Bestreiten einer in erster Instanz noch unstreitig gestellten Tatsache in der Berufungsinstanz zuzulassen, nachdem die gegnerische Partei ihrerseits das neue Vorbringen bestritten hat (§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO).*)
2. Für die Erstreckung der Interventionswirkung in subjektiver Hinsicht auf Rechtsnachfolger der im Vorprozess Beteiligten gilt § 325 ZPO entsprechend. Nach § 325 Abs. 1 ZPO wirkt das rechtskräftige Urteil u. a. für und gegen die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind. Hierunter fällt auch der Übergang des materiellen Rechts kraft Gesetzes, wie im vorliegenden Fall nach § 86 VVG.*)
3. Für die Eigenschaft einer mit Wischarbeiten in einem Hotel beschäftigten Reinigungskraft als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines Dienstvertrags (§ 278 Satz 1 Alt. 2, § 611 BGB) des mit der Säuberung der Hotelräumlichkeiten beauftragten Reinigungsunternehmens kommt es nicht entscheidend auf das Bestehen etwaiger (arbeits-)vertraglicher Beziehungen zwischen ihnen beiden an. Denn die Art der zwischen dem Schuldner und dem Erfüllungsgehilfen bestehenden rechtlichen Beziehung ist gleichgültig.*)
4. Maßgeblich ist allein, dass der Erfüllungsgehilfe als Hilfsperson nach den tatsächlichen Verhältnissen objektiv für den Schuldner tätig geworden ist, dass also der Schuldner sich im eigenen Interesse eines Dritten zur Erfüllung seiner eigenen Pflichten bedient hat.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2644
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Bremen, Beschluss vom 15.08.2024 - 1 U 14/24
1. Es findet kein Abzug Neu für Alt beim Schadensersatz für die Beschädigung eines Anpralldämpfers an einer Bundesautobahn statt, wenn es sich bei dem Anpralldämpfer nicht um ein eigenständiges Bauwerk handelt, sondern er regelmäßig mit einer Erneuerung der Gesamtanlage ausgetauscht wird.*)
2. Behauptet der Schädiger lediglich pauschal den Eintritt eines Vermögensvorteils für den Geschädigten, so genügt dies nicht für die Geltendmachung eines Abzugs Neu für Alt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2640
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LG Koblenz, Urteil vom 09.02.2024 - 8 O 40/23
1. Der Empfänger darf einer Erklärung nicht einfach den für ihn günstigsten Sinn beilegen. Er ist verpflichtet, unter Berücksichtigung aller ihm erkennbarer Umstände mit gehöriger Aufmerksamkeit zu prüfen, was der Erklärende gemeint hat.
2. Wird für die Erklärung ein Formular des Empfängers benutzt, ist darauf abzustellen, wie der Erklärende das Formular verstehen durfte.
3. Unklarheiten gehen im Zweifel zu Lasten des Verwenders einer formularmäßigen Erklärung. Das gilt entsprechend, wenn ein Vertragstext von einem sozial Überlegenen selbst entworfen wird.
4. Derjenige, der einen Vertragstext selbst formuliert, um ihn dem anderen Teil nur zur Unterschrift vorzulegen, muss im Zweifelsfalle alle Unklarheiten gegen sich gelten lassen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2574
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Köln, Urteil vom 04.07.2024 - 15 U 217/21
1. Ein Tankwagenfahrer, der zum Befüllen eines Heizöltanks eingesetzt wird, treffen vor Beginn, während und nach Abschluss des Einfüllvorgangs besondere Prüf- und Überwachungspflichten und er muss, wenn eine ordnungsgemäße Befüllung nicht sichergestellt werden kann, dieselbe ablehnen.
2. Wird Heizöl wird durch "blinden" Füllstützen gepumpt, trifft den Hauseigentümer kein Mitverschulden, wenn er bei Lieferung des Heizöls gegenüber dem Tandkwagenfahrer erklärt hat, es seien zwei Stutzen vorhanden, einer davon blind und er solle sichergehen, den richtigen davon zu wählen.
3. Der Hauseigentümer muss sich das Verschulden der Handwerker, die den Kellertank ausgebaut und bei dieser Gelegenheit die alte Rohrleitung nicht verschlossen bzw. nicht anderweitig gesichert haben, im Verhältnis zum Tankwagenfahrer bzw. dessen Arbeitgeber nicht zurechnen lassen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2527
 Wohnraummiete
Wohnraummiete
AG Neubrandenburg, Urteil vom 13.09.2023 - 103 C 292/23
1. Ist eine Einbauküche mit vermietet, ist der Vermieter auch für einen funktionstüchtigen Kühlschrank verantwortlich.
2. Kommt der Vermieter seiner Pflicht nicht nach, kann der Mieter einen Kühlschrank bestellen und die Kosten vom Vermieter verlangen.
3. Dabei ist unerheblich, ob die Bestellung bereits vor Verzug des Vermieters erfolgte, relevant ist einzig, wann der Kühlschrank geliefert und eingebaut wurde.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2425
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BAG, Urteil vom 20.06.2024 - 2 AZR 213/23
Es besteht ein Beweis des ersten Anscheins, dass Bedienstete der Deutschen Post AG Briefe zu den postüblichen Zeiten zustellen.*)
 Volltext
Volltext