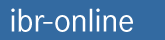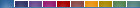Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
401 Entscheidungen insgesamt
Online seit 19. März
IBRRS 2025, 0721 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Aachen, Urteil vom 02.07.2024 - 10 O 74/22
1. Bei wucherähnlichen Geschäften, bei denen ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Höhe der vereinbarten Vergütung und der dafür zu erbringenden Leistung besteht, ist Sittenwidrigkeit dann zu bejahen, wenn weitere sittenwidrige Umstände hinzutreten, wie etwa verwerfliche Gesinnung oder die Ausnutzung der schwierigen Lage oder auch der Unerfahrenheit des Partners für das eigene übermäßige Gewinnstreben.
2. Übersteigt der Wert der Leistung den der Gegenleistung um mehr als 100 %, ist eine weitere Prüfung der subjektiven Voraussetzungen, insbesondere der verwerflichen Gesinnung, grundsätzlich entbehrlich.
 Volltext
Volltext
Online seit 17. März
IBRRS 2025, 0715 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Urteil vom 20.02.2025 - VII ZR 133/24
1. Zur Frage rechtsmissbräuchlicher Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts gem. § 355 Abs. 1, § 312g Abs. 1 BGB (hier verneint).*)
2. Ein Ausschluss des Verbraucherwiderrufsrechts wegen Rechtsmissbrauchs kommt nur ausnahmsweise unter dem Gesichtspunkt besonderer Schutzbedürftigkeit des Unternehmers, etwa bei arglistigem Verhalten des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer, in Betracht.
3. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verneinung des Widerrufsrechts nicht vor, kann die darin liegende gesetzliche Wertung nicht durch den Rückgriff auf § 242 BGB umgangen werden. Es müssen dann vielmehr weitere Umstände hinzutreten, die den nur ausnahmsweise in Betracht kommenden Einwand des Rechtsmissbrauchs rechtfertigen können.
 Volltext
Volltext
Online seit 14. März
IBRRS 2025, 0692 Werkvertrag
Werkvertrag
AG München, Urteil vom 26.10.2023 - 191 C 10665/23
1. Übernimmt der Unternehmer neben der Lieferung auch eine Aufbauverpflichtung (hier: für eine Duschkabine), hat er bei erkennbaren Ausführungshindernissen rechtzeitig Bedenken mitzuteilen.
2. Eine Bedenkenhinweispflichtverletzung kann nur angenommen werden, wenn der Unternehmer augenfällige Ausführungshindernisse nicht erkennt.
3. Ohne besonderen Anlass muss der Unternehmer vor Beginn der Arbeiten keine umfassende, über die Sichtkontrolle hinausgehende Prüfung des Materials auf Mängel durchführen.
 Volltext
Volltext
Online seit 12. Februar
IBRRS 2025, 0387 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 18.12.2024 - 4 U 218/21
1. Die Parteien eines Werkvertrags vereinbaren im Zweifel (konkludent) auch die Funktionstauglichkeit des Werks als Beschaffenheit, wozu insbesondere die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gehört.
2. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind solche technischen Regeln, die sich unter einer hinreichenden Zahl kompetenter Fachleute als theoretisch richtig durchgesetzt und die sich in der Baupraxis als richtig bewährt haben (hier bejaht für das Merkblatt "DWE M 377 (Biogas-Speichersysteme, Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit von Membranabdeckungen)").
3. Grundsätzlich ist der Lieferant von (Bau-)Stoffen oder Materialien, die der Unternehmer bei der Herstellung seines Werks verwendet, nicht Erfüllungsgehilfe des Unternehmers, sodass dieser nicht für ein Verschulden des Lieferanten haftet. Ein Verschulden des Unternehmers kann jedoch anzunehmen sein, wenn besondere Umstände vorliegen, die ihn zur Untersuchung der vom Lieferanten gelieferten Sache auf Fehlerfreiheit und einwandfreies Funktionieren hätten veranlassen müssen.
4. Der Abschluss eines (zweiten) Werkvertrags mit dem alten Unternehmer über die Beseitigung von (potentiellen) Mängeln aus einem früheren Werkvertrag kann im Einzelfall gleichzeitig als (konkludenter) Vertrag auf Erlass etwaiger Gewährleistungsansprüche ausgelegt werden. Dies ist jedoch wegen der weitreichenden Wirkung eines Erlasses nur in eindeutigen Fällen anzunehmen.
5. Eine sittenwidrige Kollusion kommt bei einem Vertragsschluss in Betracht, wenn die eine Seite mit einem (gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen) Vertreter der anderen Seite zu deren Nachteil in anstößiger Weise zusammenwirkt.
6. Beseitigt der Unternehmer die Mängel und haben die Vertragsparteien die Klärung der Mängelhaftung hintenan gestellt, kann sich der Unternehmer nicht auf eine fehlende Fristsetzung zur Nacherfüllung berufen, wenn sich später seine Pflicht zur Haftung für die Mängel herausstellt.
 Volltext
Volltext
Online seit 11. Februar
IBRRS 2025, 0375 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 17.01.2025 - 1 U 37/24
1. Die Vorleistungspflicht des Werkunternehmers, die die Zahlung des Werklohns von der Abnahme abhängig macht, ist ein gesetzliches Leitbild.
2. Ein Abweichen von diesem Leitbild führt nur dann nicht zu einer Unwirksamkeit der Klausel, wenn die Leitbildabweichung sachlich gerechtfertigt ist und der gesetzliche Schutzzweck auf andere Weise sichergestellt wird.
3. Ein Werkvertrag mit Dauerschuldcharakter (hier: Radiowerbevertrag) mit einer formularmäßig vereinbarten Vorleistungspflicht benachteiligt den Besteller unangemessen i.S.d. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 13. Januar
IBRRS 2025, 0060 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 29.08.2024 - 12 U 3/24
1. Rechtsgeschäfte, bei denen ein auffälliges Missverhältnis zwischen der versprochenen Vergütung und dem Wert der dafür zu erbringenden Leistung besteht, sind nichtig, wenn weitere Umstände hinzutreten, wie etwa eine verwerfliche Gesinnung oder die Ausbeutung der schwierigen Lage oder Unerfahrenheit des Partners für das eigene unangemessene Gewinnstreben.
2. Liegt ein grobes, besonders krasses Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vor, rechtfertigt dieser Umstand regelmäßig den Schluss auf eine verwerfliche Gesinnung des begünstigten Vertragsteils und damit auf einen sittenwidrigen Charakter des Rechtsgeschäfts.
3. Ein auffälliges, grobes Missverhältnis besteht bei Grundstückskaufverträgen sowie Kaufverträgen über vergleichbar wertvolle bewegliche Sachen regelmäßig bereits dann, wenn der Wert der Leistung annähernd doppelt so hoch ist wie derjenige der Gegenleistung. Dieser Grundsatz ist auch auf Werkverträge anzuwenden.
4. Für das Vorliegen eines auffälligen Missverhältnisses ist auf den objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen.
 Volltext
Volltext
Online seit 23. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3672 Werkvertrag
Werkvertrag
AG Hannover, Urteil vom 14.07.2023 - 539 C 1401/23
(Ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
Online seit 13. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3589 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Köln, Urteil vom 15.11.2024 - 6 U 60/24
1. Für einen wirksamen Vertragsschluss müssen grundsätzlich die für die Parteien wesentlichen Punkte, die essentialia negotii, feststehen. Essentialia negotii sind jedenfalls die Hauptleistungspflichten, also Leistung und Gegenleistung.
2. Beim Werkvertrag sind das herzustellende Werk und die zu zahlende Vergütung die essentialia negotii. Weil sich die Parteien in der Rechtswirklichkeit bei bestimmten Vertragstypen vor der Leistungserbringung nicht immer ausdrücklich über den Preis einigen, kann nach § 632 Abs. 1 BGB eine stillschweigende Preisvereinbarung an die Stelle der tatsächlichen Preisvereinbarung fingiert werden.
3. Auch im Werkvertragsrecht kann es einen Dissens über die Vergütung geben. Wenn sich beide Parteien auf eine bestimmte Vergütung einigen wollen, aber ausdrücklich keine Einigung zustande kommt, liegt trotz § 632 Abs. 1 BGB ein offener Dissens vor.
4. Kaufmännische Bestätigungsschreiben haben den Zweck, eine rechtsgeschäftliche Einigung zwischen den Parteien verbindlich zu fixieren. Erforderlich sind daher Vorverhandlungen in Gestalt eines geschäftlichen Gesprächs oder geschäftlicher Korrespondenz, sei es mündlich, schriftlich, in Textform oder auf andere Art.
5. Die Vorverhandlungen müssen nicht zu einem Vertragsschluss geführt haben. Ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben kann auch einen tatsächlich nicht erfolgten Vertragsschluss ersetzen. Erforderlich ist dann aber, dass in den Vorverhandlungen die essentialia negotii des zu schließenden Vertrags hinreichend erörtert wurden.
6. Das Bestätigungsschreiben muss zeitnah im Anschluss an die Verhandlungen beim Empfänger eingehen. Entscheidend ist, ob der Empfänger noch mit einer entsprechenden Bestätigung rechnen durfte, was auch von dem Gegenstand des Vertrags abhängt.
Online seit 10. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3534 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Oldenburg, Beschluss vom 20.10.2023 - 12 U 198/22
1. Für die Frage, welche Form der Gläubigermehrheit vorliegt, sind nicht die Eigentumsverhältnisse am Grundstück maßgeblich, sondern der das Streitverhältnis bestimmende Werkvertrag. Sind auf einer Seite des Vertrages mehrere Personen beteiligt (hier: beide Ehegatten auf Auftraggeberseite), so ist jedoch der Regelfall die Mitgläubigerschaft, alternativ kommt allenfalls die Teilgläubigerschaft in Betracht.
2. Bei Gesamtgläubigerschaft kann der Schuldner nach Belieben an jeden der Gläubiger mit befreiender Wirkung leisten, während er im Falle der Mitgläubigerschaft nur an alle gemeinschaftlich leisten kann und bei Teilgläubigerschaft nur an jeden Gläubiger zu einem - im Zweifel gleichen - Anteil.
3. Sind beide Ehegatten jeweils Auftraggeber eines Bauvertrags und richtet der eine Ehegatte in "Ich-Form" ein Nacherfüllungsverlangen an den Auftragnehmer, erfolgt das Nacherfüllungsverlangen gleichwohl im Namen auch des anderen Ehegatten, wenn in der Grußformel die Namen beider Ehegatten genannt sind.
4. Die in einem Nacherfüllungsverlangen beschriebenen Mängelerscheinungen umfassen grundsätzlich alle diesen zugrundeliegenden Mängelursachen.
5. Erwidert Auftragnehmers auf ein Mängelbeseitigungsverlangen damit, er werde "ab jetzt keine Arbeiten mehr ausführen", liegt darin eine endgültige Verweigerung der Mängelbeseitigung, die eine (erneute) Fristsetzung entbehrlich macht.
6. Die für einen Vorschussanspruch erforderliche Absicht zur Beseitigung der Mängel ist zu unterstellen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3533
 AGB
AGB
OLG Oldenburg, Urteil vom 06.02.2023 - 9 U 14/16
1. Vertragsbedingungen sind nicht ausgehandelt, wenn die für den Vertragspartner des Verwenders nachteilige Wirkung der Klausel im Zuge von Verhandlungen zwar abgeschwächt, der gesetzesfremde Kerngehalt der Klausel vom Verwender jedoch nicht ernsthaft zur Disposition gestellt wird.
2. Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen einen Haftungsausschluss für mängelbedingte Schadensersatzansprüche im Fall einfacher Fahrlässigkeit des Verwendungsgegners (Auftragnehmer) regeln, der noch dazu unabhängig davon greifen soll, ob der Verwender (Auftraggeber) konkret anderweitig gegen solche Schäden versichert ist, sind diese - auch im unternehmerischen Rechtsverkehr - unwirksam. Gleiches gilt für die zeitliche Begrenzung der Durchsetzbarkeit entsprechender Schadensersatzansprüche durch Abkürzung der gesetzlichen Verjährungsfristen.
3. Die Beauftragung eines Dritten mit der Beaufsichtigung der Ausführung (hier: Service-Techniker des Maschinenherstellers) entlastet den Auftragnehmer weder unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens oder des Zurechnungszusammenhangs noch begründet es ein Mitverschulden des Auftraggebers.
4. ...
 Volltext
Volltext
Online seit 9. Dezember 2024
IBRRS 2024, 3568 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Urteil vom 21.11.2024 - VII ZR 39/24
1. Zur Haftung des Betreibers einer Portalwaschanlage für die Beschädigung eines mit einem serienmäßigen Heckspoiler ausgestatteten Fahrzeugs.*)
2. Bei einem Vertrag über die Reinigung eines Fahrzeugs handelt es sich um einen Werkvertrag. Aus einem solchen Vertrag ergibt sich als Nebenpflicht die Schutzpflicht des Unternehmers, das Fahrzeug des Bestellers vor Beschädigungen beim Waschvorgang zu bewahren.
3. Verkehrssicherungspflichten innerhalb eines Vertragsverhältnisses sind zugleich Vertragspflichten. Die auf den Werkvertrag bezogene Verkehrssicherungspflicht des Unternehmers geht nicht weiter als die werkvertragliche Schutzpflicht des Unternehmers.
4. Der Unternehmer, der eine Gefahrenlage schafft, ist grundsätzlich dazu verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung des Eigentums des Bestellers möglichst zu verhindern.
5. Grundsätzlich trägt der Besteller die Beweislast dafür, dass der Unternehmer eine ihm obliegende Pflicht verletzt und diese Pflichtverletzung den Schaden verursacht hat. Diese Grundsätze finden auch bei der Verletzung einer Schutzpflicht Anwendung, so dass es - ohne Vorliegen besonderer Umstände - nicht genügt, dass der Besteller lediglich nachweist, dass ihm im Zusammenhang mit der Durchführung eines Werkvertrags ein Schaden entstanden ist.
6. Liegen die für den Schaden in Betracht kommenden Ursachen allein im Obhuts- und Gefahrenbereich des Unternehmers, hat er sich hinsichtlich seines Verschuldens nicht nur zu entlasten, sondern auch darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass ihn keine Pflichtverletzung trifft.
Online seit 2024
IBRRS 2024, 3343 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Frankfurt, Beschluss vom 19.08.2024 - 16 U 46/24
1. Die Frage, ob sich aus einem Rahmenvertrag eine Verpflichtung des Bestellers zur Erteilung von Einzelaufträgen gegenüber dem Unternehmer ergibt, beurteilt sich nach den im Rahmenvertrag dazu getroffenen Regelungen.
2. Enthält der Rahmenvertrag die ausdrückliche Regelung, wonach eine Verpflichtung zur Erteilung von Einzelaufträgen für den Besteller nicht besteht, ist für eine Auslegung kein Raum.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3342
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Frankfurt, Urteil vom 25.09.2024 - 16 U 46/24
1. Die Frage, ob sich aus einem Rahmenvertrag eine Verpflichtung des Bestellers zur Erteilung von Einzelaufträgen gegenüber dem Unternehmer ergibt, beurteilt sich nach den im Rahmenvertrag dazu getroffenen Regelungen.
2. Enthält der Rahmenvertrag eine ausdrückliche Regelung, wonach eine Verpflichtung zur Erteilung von Einzelaufträgen für den Besteller nicht besteht, ist für eine Auslegung kein Raum.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3373
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Darmstadt, Urteil vom 08.11.2024 - 19 O 73/24
Wird die Kapazität eines Energiespeichers per Fernwartung auf 70% der Maximalkapazität heruntergefahren, liegt darin ein Mangel der Werkleistung bzw. Sache.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3371
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Darmstadt, Urteil vom 08.11.2024 - 19 O 98/22
1. Ein Gerüstbauvertrag ist ein typengemischter Vertrag, der mit- und werkvertragliche Elemente aufweist.
2. Die Werkleistung bezieht sich bei einem Gerüstbauvertrag auf den Aufbau des Gerüsts. Die Abnahme ist bei der Ingebrauchnahme nach Aufbau anzunehmen.
3. Wer über neun Jahre hinweg ein Baugerüst am Haus stehen hat und jährlich unbeanstandet Abschlagsrechnungen begleicht, die die Gerüstfläche ausweisen, kann nicht nach Abbau des Gerüsts im Abrechnungsprozess einwenden, die Gerüstfläche habe nicht zugetroffen. Ein solcher Einwand verstößt gegen Treu und Glauben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 3252
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Oldenburg, Urteil vom 05.11.2024 - 2 U 93/24
1. Nach Abnahme des Werks kommt der Eintritt des Verzugs mit der Herstellungsverpflichtung nicht mehr in Betracht.*)
2. Der Verzug mit der Nacherfüllungsverpflichtung gem. § 634 Nr. 1, § 635 Abs. 1 BGB setzt grundsätzlich eine Mahnung voraus. Fordert der Besteller den Unternehmer auf, den Mangel "schnellstmöglich, spätestens bis zum ..." zu beseitigen, können darin eine befristete Mahnung ("schnellstmöglich") und eine Fristsetzung zur Nacherfüllung ("spätestens bis zum ...") liegen.*)
3. Verbindet der Besteller ein solches Nachbesserungsverlangen mit der Maßgabe, Termine unter Einhaltung einer Vorlaufzeit mit ihm abzusprechen, kann dies geeignet sein, die Frist für den Eintritt der Mahnung hinauszuschieben.*)
4. Zur Frage der Anspruchsgrundlage auf Schadensersatz wegen eines werkmangelbedingten Nutzungsausfallschadens ("erweitertes Leistungsinteresse").*)
5. Ein Schadensersatzanspruch wegen werkmangelbedingten Nutzungsausfalls gem. § 634 Nr. 4, § 280 Abs. 1 BGB kann wegen eines überwiegenden Mitverschuldens des Bestellers ausgeschlossen sein, wenn der Besteller ihm bekannte Mängel dem Unternehmer nicht anzeigt, die jener vor Schadenseintritt beseitigt hätte.*)
IBRRS 2024, 3131
 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Beschluss vom 26.09.2024 - I ZR 161/23
Kann der Auftragnehmer die von ihm erbrachten Leistung nicht durch ein Aufmaß ermitteln, genügt er seiner Verpflichtung zur prüfbaren Abrechnung, wenn er alle ihm zur Verfügung stehenden Umstände mitteilt, die Rückschlüsse auf den Stand der erbrachten Leistung ermöglichen (vgl. BGH, IBR 2004, 488).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2982
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 16.05.2024 - 2 U 79/23
1. Ist ein von einem hierauf spezialisierten Unternehmen zur Brauchwassergewinnung errichteter Brunnen funktionsuntauglich, weil er stark salzhaltiges Wasser fördert, so sind Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz nach § 634 Nr. 4, §§ 636, 280, 281 BGB auch ohne Aufforderung zur Mängelbeseitigung begründet.*)
2. In Abhängigkeit vom konkreten Vertragsinhalt stellt das Fortbestehen des nutzlosen Bauwerks unter Umständen keinen Schaden dar, so dass keine Verpflichtung zum Rückbau besteht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2928
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 25.06.2024 - 5 U 38/23
1. Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung liegt beim Einbau einer Küche für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eines neu errichteten Wohnhauses ein Bauvertrag vor.
2. Eine formularmäßige Skontoklausel, nach der der gesamte Zahlbetrag "fällig bis zum Tage der Lieferung und Rechnungsstellung" sein soll, ist wegen unzulässiger Einschränkung des Zurückbehaltungsrechts des Kunden unwirksam.
3. Erklärt eine Skontoklausel die Rechnungsstellung als maßgeblich für die Fälligkeit, benachteiligt dies den Kunden ebenfalls unangemessen.
4. Die zeitliche Einschränkung der Zahlung "am Tage der Lieferung und Rechnungsstellung" benachteiligt den Kunden unangemessen, da hierdurch die Notwendigkeit einer Mahnung entfällt. Dies gilt unabhängig davon, dass eine Bar- oder Sofortzahlung dem Kunden auch nicht zumutbar ist, wobei sich die faktische Einschränkung der Zahlungsmethode sowohl als eine unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 Abs. 1 BGB darstellt als auch - selbst bei Individualabreden - nach § 312a Abs. 4 Nr. 1 BGB unwirksam ist.
5. Die Vereinbarung der Zahlung eines "Skontobetrags", der mehr als 20% des "Küchengesamtpreises" ausmacht, ist als Vertragsstrafe zu werten und aufgrund dieses Umfangs unwirksam.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2908
 Bauhaftung
Bauhaftung
OLG Frankfurt, Urteil vom 04.09.2024 - 9 U 58/22
1. Derjenige, der selbst dazu berufen ist, eine Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen, unterfällt nicht deren persönlichen Schutzbereich.*)
2. Bei einer durch Unterlassen oder einer lediglich mittelbar herbeigeführten Rechtsgutsverletzung hängt die Haftung des Schädigers nach § 823 Abs. 1 BGB von einer Abwägung der Interessenlage ab. Hierbei ist in besonderem Maße auf die konkreten Verantwortungsbereiche der Beteiligten abzustellen, wenn die Garantenstellung aus einer rechtlichen Sonderbeziehung hergeleitet werden soll.*)
3. Zur Frage einer Beweislastumkehr zugunsten der Geschädigten für ihre Behauptung, ein unfallursächlicher Materialriss in einer Kesselumwälzpumpe habe schon zum Zeitpunkt einer Materialprüfung vorgelegen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2832
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Celle, Urteil vom 04.04.2024 - 2 U 34/23
1. Ein wirksamer Werkertrag setzt eine Einigung über die sog. essentialia negotii (wesentliche Bestandteile des Rechtsgeschäfts) voraus, wofür es ausreicht, dass die beiderseits geschuldeten Leistungen bestimmt oder zumindest eindeutig bestimmbar sind. Dabei verlangt die Bestimmbarkeit ein deutlich geringeres Maß an Genauigkeit.
2. Auch wenn der konkrete Leistungsumfang nicht im Detail niedergelegt ist, ist die Leistung hinreichend bestimmt, wenn sich aus dem Vertrag die für einen Werkvertrag prägenden wechselseitigen Hauptleistungspflichten der Parteien ergeben. Eine (detaillierte) Leistungsbeschreibung stellt dann lediglich eine weitergehende Konkretisierung der vereinbarten Leistungspflichten dar.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2777
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Saarbrücken, Urteil vom 06.08.2024 - 2 U 75/23
Ein auf den nachträglichen Einbau eines zu liefernden Batteriespeichers gerichteter Vertrag stellt im Regelfall einen Kaufvertrag mit Montageverpflichtung und keinen Werkvertrag dar.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2697
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 19.04.2024 - 12 U 9/23
1. Bei einem Gebäudereinigungsvertrag handelt es sich regelmäßig um einen Werkvertrag und nicht um einen Dienstvertrag, denn der Unternehmer schuldet die Sauberkeit von Räumen mit von ihm auszusuchendem Personal, ohne dabei den Weisungen des Auftraggebers zu unterliegen. Zu den vertragsgemäßen Hauptleistungspflichten gehört typischerweise die Herstellung des Reinigungserfolgs, nicht hingegen die Erbringung einer vertraglich vereinbarten Stundenzahl.
2. Sieht der Vertrag die Vorlage bestimmter Arbeits- und Leistungsnachweise als Fälligkeitsvoraussetzung für einen Vergütungsanspruch vor, wird diese Regelung von den Parteien stillschweigend abbedungen, wenn die Zahlungen vom Auftraggeber nach der gelebten Praxis geleistet werden, ohne dass sich dieser auf die Nichtvorlage der Nachweise beruft.
3. Sieht der Vertrag vor, dass der Unternehmer den Erfolg der Reinigungsarbeiten in Eigenkontrolle zu prüfen hat, ist das Erfordernis einer Abnahme abbedungen.
4. Unabhängig davon, ob die Reinigungsleistung nach ihrer Eigenart ein "flüchtiges Gewerk" darstellt, ist dem Auftraggeber eine Mängelbeseitigungsaufforderung grundsätzlich möglich und angesichts der heutigen Kommunikationstechnologie auch zumutbar. Ob der Unternehmer genügend "Springer" zur Durchführung der Nachbesserung im Einsatz hat, ist irrelevant, da die Nichtdurchführung auf Grund unzureichender Personaldecke allein zur Fruchtlosigkeit der Mängelbeseitigungsaufforderung führen würde, was wiederum das Minderungsrecht der Beklagten eröffnen würde.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2358
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Lübeck, Urteil vom 25.07.2024 - 14 S 109/22
1. Ein Vertrag über die Reinigung von (Ferien-)Wohnungen ist als Werkvertrag zu qualifizieren.
2. Die Vergütung ist grundsätzlich bei der Abnahme des Werks zu entrichten und damit fällig. An die Stelle der Abnahme tritt die Vollendung des Werks, wenn nach der Beschaffenheit des Werks die Abnahme ausgeschlossen ist.
3. Verpflichtet sich der Unternehmer dazu, Reinigungsleistungen gemäß einer vom Besteller zu erstellenden Reinigungsliste über eine unbestimmte Anzahl von Ferienwohnungen zu erbringen, ist die Leistung grundsätzlich nicht abnahmebedürftig. Die werkvertraglichen Mängelrechte sind anzuwenden, wenn der Unternehmer die Leistung in Erfüllung seiner gesamten Verbindlichkeit erbracht hat (Anschluss an BGH, IBR 2013, 646).
4. Der Unternehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Vollendung seiner Leistung. Vollendung liegt vor, wenn eine vollständige Fertigstellung der Werkleistung gegeben ist. Hierfür muss der Unternehmer grundsätzlich alle geschuldeten Leistungen erbracht haben. Verbleibende Mängel schließen eine Vollendung nicht aus.
5. Will der Besteller Gewährleistungsrechte geltend machen, muss er substantiiert darlegen, dass ein Mangel an dem von dem Unternehmer fertiggestellten Werk besteht. Dabei kann es ausreichen, wenn der Besteller auf konkrete Symptome hinweist.
6. Ein Werkvertrag ist nicht deshalb nichtig, weil der Unternehmer seine Mitarbeiter "schwarz" bezahlt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2370
 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Urteil vom 25.06.2024 - X ZR 97/23
1. Eine Verantwortlichkeit des Gläubigers i.S.v. § 323 Abs. 6 Fall 1 BGB und § 326 Abs. 2 Satz 1 Fall 1 BGB kann auch dann anzunehmen sein, wenn die Auslegung des Vertrags ergibt, dass der Gläubiger nach der vertraglichen Gestaltung das Risiko eines bestimmten Leistungshindernisses ausdrücklich oder konkludent übernommen hat und sich dieses Leistungshindernis verwirklicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 26.01.2023 - IX ZR 17/22, Rn. 9, IBRRS 2023, 0744; Urteil vom 13.01.2011 - III ZR 87/10, IBRRS 2011, 0528 = IMRRS 2011, 0387; Urteil vom 11.11.2010 - III ZR 57/10, IBRRS 2011, 4053 = IMRRS 2011, 2885; Urteil vom 18.10.2001 - III ZR 265/00, IBRRS 2001, 0195 = IMRRS 2001, 0083).*)
2. Die stillschweigende Übernahme eines Risikos kommt insbesondere in Betracht, wenn dieses schon bei Vertragsschluss bestanden hat und nur eine Vertragspartei in der Lage war, es abzuschätzen, oder wenn seine Verwirklichung von persönlichen Verhältnissen eines Vertragspartners abhängt, die der andere Teil nicht beeinflussen kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 18.10.2001 - III ZR 265/00, IBRRS 2001, 0195 = IMRRS 2001, 0083; Urteil vom 11.11.2010 - III ZR 57/10, IBRRS 2011, 4053 = IMRRS 2011, 2885).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 2103
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Köln, Urteil vom 24.11.2023 - 6 U 76/23
1. Der Besteller kann bei Werkmängeln alternativ entweder mindern oder das Vertragsverhältnis beenden. Es steht außer Frage, dass er wegen eines anderen, z. B. später auftretenden Mangels, erneut mindern kann.
2. Verschärft sich nach Ausspruch der Minderung die Schlechtleistung noch weiter, stehen dem Besteller erneut Gewährleistungsrechte zu. Die Ausübung des Minderungsrechts schließt weder eine weitere Minderung noch den Rücktritt aus.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1985
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Frankfurt, Beschluss vom 11.05.2024 - 3 U 193/19
1. Der Vergütungsanspruch beim Dienstvertrag entsteht anders als beim Werkvertrag nicht durch den Eintritt eines Leistungserfolgs, sondern bei fortlaufend geschuldeten Diensten allein mit Ablauf des Zeitabschnitts, für den jeweils die Vergütung geschuldet ist.
2. Das Dienstvertragsrecht kennt keine Gewährleistung. Der Vergütungsanspruch kann daher nicht kraft Gesetzes wegen mangelhafter Dienstleistung gemindert werden oder ganz entfallen.
3. Zum Ausgleich für die fehlende Gewährleistung hat der Dienstherr das Recht schon auf die Ausführung der Dienstleistung durch die Erteilung von konkreten Weisungen Einfluss zu nehmen und den Dienstvertrag notfalls zu kündigen.
4. Ein Schadensersatzanspruch des Dienstherrn wegen (teilweiser) Nichterfüllung des Beratungsvertrags besteht nur im Ausnahmefall, wenn die Schlechtleistung wegen völliger Unbrauchbarkeit der erbrachten Dienstleistung einer Nichtleistung gleichsteht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1854
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 04.03.2024 - 2-31 O 587/23
Der Auftraggeber einer Rahmenvereinbarung über die Erbringung von Werkleistungen ist jedenfalls dann nicht zum Abruf von Einzelaufträgen verpflichtet, wenn die Rahmenvereinbarung eine Regelung enthält, nach der eine solche Verpflichtung ausdrücklich nicht besteht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1833
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Bremen, Urteil vom 01.04.2022 - 2 U 40/21
Eine Preisanpassungsklausel in einem Wartungsvertrag, nach der sich die Erhöhung des Leistungsentgelts an dem Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte und dem Tarifindex für Arbeitnehmer des Deutschen Statistischen Bundesamts orientiert, kann bei ihrer Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr der Inhaltskontrolle gem. § 307 Abs. 1 BGB standhalten, auch wenn für den (nicht zu erwartenden) Fall des Absinkens der Indices eine Preisanpassung nicht vorgesehen ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1781
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Detmold, Urteil vom 15.05.2024 - 1 O 5/24
1. Ein Batteriespeicher, der statt der vereinbarten Speicherkapazität von 10,00 kWh lediglich eine Speicherkapazität von nur ca. 7,00 kWh aufweist, ist mangelhaft.
2. Erbringt der Unternehmer die Leistung nicht vertragsgemäß, kann der Besteller von dem (Werk-)Vertrag zurücktreten, wenn er dem Unternehmer zuvor eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt hat und diese Frist fruchtlos verstrichen ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1737
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Wiesbaden, Urteil vom 20.06.2023 - 9 O 314/21
1. Eine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage wegen einer Mengenunterschreitung scheidet aus, wenn sich die Mindermengen noch innerhalb des Rahmens einer zumutbaren Abweichung bewegen (hier bejaht).
2. Unzumutbar ist für die benachteiligte Partei ein Festhalten am unveränderten Vertrag immer dann, wenn eine am hypothetischen Parteiwillen orientierte Auslegung zu einer anderen Vertragsregelung führt. Entscheidend dafür ist die Risikozuweisung, die sich an der vertraglichen und gesetzlichen Risikoverteilung, der Vorhersehbarkeit und der Zurechenbarkeit der eingetretenen Störung orientiert.
3. Die Unzumutbarkeitsschwelle wird dadurch erhöht, dass die eingetretenen Störungen für beide Parteien vorhersehbar waren und diese entsprechende Vorsorge hatten treffen können.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1696
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Beschluss vom 05.02.2024 - 5 U 134/23
1. Errichtet ein Werkunternehmer infolge eines Planungsfehlers einen Zaun teilweise auf dem Nachbargrundstück, kann der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wegen Werkmangels jedenfalls dann nicht nach den fiktiven Mängelbeseitigungskosten berechnet werden, wenn ein (befürchteter) Beseitigungsanspruch des Nachbarn nach nachbarrechtlichen Vorschriften zeitlich ausgeschlossen ist.*)
2. Der Schaden kann nach dem Wert der Teile des Zauns geschätzt werden, die wesentlicher Bestandteil des Nachbargrundstücks werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1592
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Lübeck, Urteil vom 20.02.2024 - 10 O 91/23
1. Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung.
2. Die Abgrenzung zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht richtet sich (gerade bei einer Einbauküche) danach, ob bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt auf der Verpflichtung zur Verschaffung von Eigentum und Besitz (dann Kaufrecht) oder auf der Montageleistung (dann Werkvertragsrecht) liegt.
3. Berechnet der Küchenbauer (Verkäufer) für die Montage lediglich eine Pauschale i.H.v. 5% des vereinbarten Gesamtpreises, stellt die Montageleistung im Vergleich zum Erwerb der Möbel und Elektrogeräte eine lediglich untergeordnete Leistung dar.
4. Eine vom Verkäufer vorformulierte Vertragsklausel, wonach der vollständige (Rest-)Kaufpreis bereits vor der Montage in bar zu bezahlen ist, benachteiligt den Käufer unangemessen und ist unwirksam.
5. Der Verlust der Nutzungsmöglichkeit an einer noch nicht gelieferten Küche stellt keinen Vermögensschaden dar. Vom Verlust eines Gebrauchsvorteils kann nur gesprochen werden, wenn die Sache bereits existiert, dem Nutzungsberechtigten aber vorenthalten wird (wie LG Kassel, IBR 1991, 381; entgegen LG Tübingen, Urteil vom 05.01.1989 - 1 S 145/88, IBRRS 1989, 0717).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1590
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Aachen, Urteil vom 22.02.2023 - 10 O 411/22
1. Werkvertragsrecht ist nur anwendbar, wenn sich der Besteller zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet. Soll der Unternehmer unentgeltlich tätig werden, ist der Vertrag nicht als Werkvertrag, sondern als Schenkung des errichteten Werks oder als Auftrag zu qualifizieren.
2. Für die Frage der Entgeltlichkeit ist allein das Verhältnis zwischen den Vertragsparteien maßgeblich. Eine Vergütung durch Dritte vermag an der Unentgeltlichkeit selbst dann nichts zu ändern, wenn sie vor Auftragsausführung erfolgt.
3. Bei einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter werden gegenüber Dritten lediglich Obhutspflichten begründet, ohne dem Dritten gleichzeitig den Anspruch auf die vertragliche Hauptleistung zuzuwenden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1418
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Hamburg, Urteil vom 28.10.2022 - 1 U 39/19
(ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 1217
 Werkvertrag
Werkvertrag
BGH, Urteil vom 18.01.2024 - VII ZR 142/22
Zur ergänzenden Vertragsauslegung (hier: Rücktrittsrecht) eines im Zusammenhang mit einem Mietvertrag abgeschlossenen Bewirtungsvertrags.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0921
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Gießen, Urteil vom 01.03.2023 - 1 S 148/21
1. Der Besteller eines Reparaturauftrags hat in der Regel ein erkennbares Interesse daran, bei zwei als technisch gleichwertig einzustufenden Reparaturwegen den jeweils günstigeren bzw. weniger zeitaufwändigen auszuwählen (vgl. BGH, IBR 2017, 683).
2. Bestehen mehrere technisch gleichwertige Reparaturmöglichkeiten, trifft den Werkunternehmer die (Neben-)Pflicht, dies dem Besteller mitzuteilen. Das Unterlassen stellt sich als ersatzpflichtige Pflichtverletzung dar, die im Ergebnis durch die Zahlung von Schadensersatz auszugleichen ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0829
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Frankfurt, Urteil vom 23.11.2022 - 29 U 108/20
1. Ein Vertrag über die Dokumentation von Baumängeln und deren monetärer Bewertung ist als Werkvertrag zu qualifizieren. Das gilt auch dann, wenn es im Angebot heißt, dass auf den Vertrag die Vorschriften über den Dienstvertrag Anwendung finden.
2. Die Erklärung des Auftraggebers "Hau ab! Ich bin fertig mit Dir!", kann als fristlose Kündigung verstanden werden. Für die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung ist aber nicht nur die Kündigungserklärung erforderlich, sondern auch das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrunds.
3. Haben die Parteien eines Werkvertrags vereinbart, dass der Vertrag nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann, kann eine aus wichtigem Grund erklärte Kündigung nicht in eine sog. freie Kündigung umgedeutet werden, wenn kein wichtiger Kündigungsgrund vorliegt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0771
 Kauf und Werklieferung
Kauf und Werklieferung
LG Saarbrücken, Urteil vom 29.09.2022 - 10 S 21/21
1. Für die Abgrenzung von Kauf- und Werklieferungsverträgen einerseits und Werkverträgen andererseits ist maßgeblich, auf welcher der Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt.
2. Liegt der Schwerpunkt des Vertrags auf der mit dem Warenumsatz verbundenen Übertragung von Eigentum und Besitz, liegt ein Kauf- oder Werklieferungsvertrag vor. Liegt der Schwerpunkt des Vertrags dagegen nicht auf dem Warenumsatz, sondern schuldet der Unternehmer die Herstellung eines funktionstauglichen Werks, ist ein Werkvertrag anzunehmen.
3. Ein Vertrag über die Übertragung des Eigentums und des Besitzes an einem Sattel, der aus verschiedenen Fertigprodukten auf Maß individuell angepasst wurde, ist ein Kaufvertrag.
4. Eine Kaufsache ist mangelhaft, wenn sie zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Allein der Umstand, dass die Verkäufer nach Gefahrübergang Änderungen an der Kaufsache vorgenommen hat, belegt nicht, dass sie zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft war, wenn es üblich ist, dass nach Fertigung weitere Termine zur sog. Feinabstimmung erfolgen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0460
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Hamm, Beschluss vom 23.01.2023 - 25 U 57/22
ohne amtliche Leitsätze
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0539
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 01.02.2023 - 12 U 63/20
Auf einen (Werk-)Vertrag über die Aufstellung einer fest mit dem Dach verbunden Photovoltaikanlage findet die fünfjährige Verjährungsfrist für Arbeiten bei Bauwerken Anwendung (vgl. BGH, IBR 2019, 203).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0640
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Celle, Urteil vom 07.02.2024 - 14 U 113/23
1. Bei einem Vertrag über die Reinigung eines Kraftstofftanks besteht eine Schutzpflicht des reinigenden Fachunternehmens, die Rechtsgüter des Auftraggebers vor Beschädigungen beim Reinigungsvorgang zu bewahren. Es handelt sich dabei um einen Unterfall einer Verkehrssicherungspflicht als vertraglicher Nebenpflicht.*)
2. Der Auftragnehmer genügt grundsätzlich seiner Verkehrssicherungspflicht, wenn die von ihm übernommenen Arbeiten den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.*)
3a. Die Beweislast für die objektive Pflichtverletzung, für den eingetretenen Schaden und für den Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden trägt zwar im Grundsatz der Gläubiger. Etwas Anderes kann allerdings dann gelten, wenn als Schadensursache nur solche aus dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Schuldners in Betracht kommen. Steht demnach fest, dass als Schadensursache nur eine solche aus dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Schuldners in Betracht kommt, muss dieser sich nicht nur hinsichtlich der subjektiven Seite, sondern auch hinsichtlich der objektiven Pflichtwidrigkeit entlasten.*)
3b. Diese Beweislastverteilung gilt auch bei einer Schadensersatzhaftung, wenn die genaue Ursache nicht aufgeklärt werden kann.*)
4a. Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 1112 Teil 1) zu Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten (Beurteilung und Schutzmaßnahmen) können zur Beurteilung der Sicherheit der durchgeführten Arbeiten herangezogen werden.*)
4b. Die technischen Regelungen zum Betriebsschutz geben im Anwendungsbereich als Zusammenfassung die für den Umgang mit Explosionsgefahren geltenden anerkannten Regeln der Technik und den Stand der geforderten Schutz- und Gefahrenbeurteilungsmaßnahmen wieder und sind somit zur Bestimmung des nach der Verkehrsauffassung zur Sicherheit Gebotenen geeignet.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2024, 0459
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 25.06.2022 - 2 U 63/18
1. Der Auftraggeber kann keine Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn er den behaupteten Mangel nicht ordnungsgemäß anzeigt. Der Mangel muss zumindest hinsichtlich seines äußeren objektiven Erscheinungsbildes so genau beschrieben werden, dass der Auftragnehmer zweifelsfrei ersehen kann, was im Einzelnen beanstandet bzw. welche Abhilfe von ihm verlangt wird.
2. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt im VOB/B-Vertrag eine fristgebundene Aufforderung zur Mängelbeseitigung voraus.
3. Eine individualvertraglich vereinbarte Verjährungsfrist für Mängelansprüche gilt nicht für den Fall des arglistigen Verschweigens von Mängeln.
4. Dem umfassend mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten oder Ingenieur obliegt im Rahmen seiner Betreuungsaufgaben nicht nur die Wahrung der Auftraggeberrechte gegenüber dem Bauunternehmer, sondern auch und zunächst die objektive Klärung von Mangelursachen, selbst wenn zu diesen eigene Planungs- oder Aufsichtsfehler gehören.
5. Die dem Architekten bzw. Ingenieur vom Bauherrn eingeräumte Vertrauensstellung gebietet es, diesem im Laufe der Mängelursachenprüfung auch Mängel des eigenen Werks zu offenbaren, so dass der Bauherr seine Auftraggeberrechte auch gegen den Bauüberwacher rechtzeitig vor Eintritt der Verjährung wahrnehmen kann.
6. Ist die sog. Sekundärhaftung begründet, so führt sie dazu, dass sich der Architekt bzw. Ingenieur nicht auf die Einrede der Verjährung des gegen ihn gerichteten Gewährleistungsanspruchs berufen darf.
Online seit 2023
IBRRS 2023, 3160 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Schleswig, Urteil vom 27.10.2022 - 11 U 23/20
1. Wird ein Unternehmer mit der Demontage einer Siebanlage beauftragt, hat er die Zerlegungsarbeiten mittels Schneidbrennern so durchzuführen, dass Brände vermieden werden.
2. Beim Einsatz von Schneidbrennern sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Bereitstellung von Feuerlöschern reicht jedenfalls dann nicht aus, wenn bei der Durchführung der Arbeiten solche Teile der Anlage in Brand geraten können, die nicht ungehindert zugänglich sind.
3. Zur Schadensberechnung bei der Beschädigung einer gebrauchten Maschine.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 3038
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Jena, Urteil vom 11.07.2023 - 7 U 328/20
1. Der Besteller eines Werks hat das Recht, einen Werkmangel selbst zu beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen, wenn er dem Unternehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat und diese erfolglos abgelaufen ist.
2. Der Unternehmer kann die Nacherfüllung verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Unverhältnismäßigkeit in diesem Sinn ist in aller Regel nur dann anzunehmen, wenn einem objektiv geringen Interesse des Bestellers an einer mangelfreien Vertragsleistung ein ganz erheblicher und deshalb vergleichsweise unangemessener Aufwand gegenübersteht.
3. Hat der Besteller objektiv ein berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags, kann ihm der Unternehmer regelmäßig die Nachbesserung wegen hoher Kosten der Mängelbeseitigung nicht verweigern.
4. Die von einem Besteller vorformulierte Klausel, wonach die Gewährleistungsfrist für Mängel fünf statt zwei Jahre beträgt, benachteiligt den Unternehmer nicht unangemessen, wenn ein Werk herzustellen ist, bei dem Mängel häufig vorkommen und erfahrungsgemäß oft erst später als fünf Jahre nach der Abnahme auftreten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 3110
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Hagen, Urteil vom 06.09.2023 - 21 O 75/20
1. Eine unangemessene Benachteiligung (§ 307 BGB) des Gerüstbauers liegt in einer Komplettheitsklausel bei einem Detailpauschalvertrag, wenn diese nach ihrem äußeren Erscheinungsbild für mehrere Verträge formulierte Klausel vom Auftraggeber gestellt wird und das Leistungsverzeichnis mit Positionen zu Gerüstmengen- und Vorhaltezeiten vom Auftraggeber stammt.*)
2. Es liegt kein den Auftraggeber bindender Vergleich über die Vergütungsansprüche vor, wenn eine Kürzung der Schlussrechnung zwischen dem Architekten und dem Unternehmer besprochen wird und der Unternehmer die vom Architekten vorgenommenen Kürzungen akzeptiert. Auch führt diese Prüfung nicht zu einem der Auftraggeberin zurechenbaren Anerkenntnis der Vergütungsansprüche. Es kann allerdings ein qualifiziertes Bestreiten der Auftstellmengen und -zeiten von dem Auftraggeber erwartet werden. Wenn ein Architekt eine Rechnungsprüfung durchgeführt hat, liegen nämlich tatsächliche Wahrnehmungen des Architekten vor, zu denen sich der Auftraggeber beim Architekten erkundigen kann.*)
3. Mengenänderungen machen nur dann eine Preisanpassung im Rahmen von § 2 Abs. 3 VOB/B erforderlich, wenn eine der Vertragsparteien diese geltend macht. Die Klage des Unternehmers ist daher schlüssig, wenn er nach den ursprünglichen Vertragspreisen abrechnet und auch der Auftraggeber keine Preisanpassung verlangt.*)
4. Soweit es bei einem Gerüstbauvertrag überhaupt einer Abnahme bedarf, ist diese für die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs entbehrlich, wenn ein reiner Abrechnungsstreit vorliegt und der Auftraggeber keine Nacherfüllung mehr verlangt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 3016
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 01.12.2022 - 4 U 30/22
Wird der Auftragnehmer mit Dachreinigungs- und -beschichtungsarbeiten (hier: Schließung von Poren zwecks Verzögerung weiterer Erosion und der Unterdrückung von Bewuchs) beauftragt, kommt dies einer Erneuerung des Daches nicht gleich. Derart konservierende und optische, nicht erneuernde Maßnahmen sind keine Bauwerksarbeiten, so dass Mängelansprüche des Auftraggebers der (nur) zweijährigen Verjährungsfrist unterliegen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 2938
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Hannover, Urteil vom 05.05.2023 - 17 O 120/21
1. Einen fachkundigen Besteller muss der Unternehmer nicht darauf hinweisen, dass sich das Werk nur für die gewöhnliche Verwendung eignet.
2. Weigert sich der Besteller, das fertig gestellte Werk wegen behaupteter wesentlicher Mängel abzunehmen, ist darin eine endgültige Verweigerung der Abnahme zu sehen, sodass es einer Abnahme für die Fälligkeit der Vergütung nicht bedarf.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 2866
 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 20.09.2023 - 7 U 90/22
1. Eine Vereinbarung über die Absicherung eines Schwer- und Großraumtransports mit einem Begleitfahrzeug stellt einen Werk- und keinen Frachtvertrag dar.
2. Macht der Besteller eines Werkvertrags Schadensersatzansprüche gegen den Unternehmer mit der Behauptung geltend, er (der Besteller) habe aufgrund einer Vertragsverletzung des Unternehmers Schadensersatz an einen Dritten leisten müssen, muss er darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass er gegenüber dem Dritten zum Schadensersatz verpflichtet war.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2023, 2640
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Leipzig, Urteil vom 30.06.2022 - 04 HK O 985/21
ohne amtlichen Leitsatz
 Volltext
Volltext