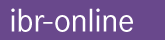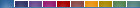Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
7675 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2020
IBRRS 2020, 1369 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 28.04.2020 - 21 U 76/19
1. Sieht ein Werkvertrag eine Bedarfsposition vor, wonach der Vorhalt eines Produktionsmittels mit einem bestimmten Betrag pro Zeiteinheit zu vergüten ist, steht dem Unternehmer eine Vergütung jedenfalls für den Zeitraum zu, in dem er das bezeichnete Produktionsmittel aufgrund des Annahmeverzugs des Bestellers für diesen bereitgehalten hat (§ 631 Abs. 1 BGB). Einer Anordnung des Bestellers bedarf es nicht.*)
2. Eine solche Bedarfsposition bestimmt zugleich die Höhe des Entschädigungsanspruchs des Unternehmers aus § 642 BGB wegen des Vorhalts des Produktionsmittels.*)
3. In einem solchen Fall bestehen Vergütungsanspruch aus § 631 Abs. 1 BGB und Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB nebeneinander in Anspruchskonkurrenz.*)
4. Während des Annahmeverzugs des Bestellers kann der Unternehmer seine Produktionsmittel nicht unbegrenzt gegen Vergütung bzw. Entschädigung für den Besteller vorhalten. Er hat den Vorhalt eines Produktionsmittels zu beenden, wenn ihn der Besteller dazu anweist. Ansonsten hat er über die Dauer des Vorhalts eine vertretbare Entscheidung zu treffen, bei der die Besonderheiten des Einzelfalls und das berechtigte Bestellerinteresse zu berücksichtigen sind, vor unnötigen Ausgaben geschützt zu werden.*)
IBRRS 2020, 1166
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 17.10.2018 - 27 U 1156/18 Bau
1. Der Umstand, dass die Leistung (hier: Dachabdichtungarbeiten) nach Durchführung der Mängelbeseitigung regelmäßig (hier: alle fünf bis zehn Jahre) gewartet werden muss, macht die Mängelbeseitigung nicht unverhältnismäßig.
2. Wartung heißt nicht, dass die Mängelbeseitigung turnusgemäß vollständig wiederholt werden muss. Wartung bedeutet zunächst lediglich eine - vielfach auf optische Sichtkontrolle beschränkte - Nachschau, ob die Mängelbeseitigungsmaßnahme nach wie vor ihren Zweck erfüllt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1293
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.02.2020 - 22 U 548/19
1. Ein typischer Geschehensablauf (i.S.d. Anscheinsbeweises) kann darin liegen, dass bei einer Kondensatbildung an der Innenseite von (hochwertigen, als solchen thermisch getrennten) Fensterelementen die allgemeine Lebenserfahrung dafür spricht, dass Ursache dafür typischerweise Einbaufehler des Werkunternehmers sind.*)
2. Ein solcher typischer Geschehensablauf (Anschein) ist auch dann gegeben, wenn nach sachverständigen Feststellungen (mit Bauteilöffnungen) an jeweils typischen Fenstern bei dem Einbau von jeweils gleichartigen Fenstern unter jeweils gleichartigen Einbaubedingungen erhebliche Regelwidrigkeiten bei der Ausbildung bzw. Dämmung der umlaufenden Anschlussfugen zum Baukörper (Klinkerfassade) bzw. der unteren Anschlussfugen zum Baukörper (WDVS-Fassade) festzustellen sind, so dass nach der Lebenserfahrung darauf geschlossen werden kann, dass diese Regelwidrigkeiten auch an den anderen vom Werkunternehmer zeitgleich eingebauten Fensterelementen "systematisch" vorhanden sind.*)
3. Dies gilt erst recht, wenn die vom Werkunternehmer selbst geschuldete, von ihm auch tatsächlich erstellte und dann der Ausführung seiner Werkleistungen zu Grunde gelegte Ausführung-/Montageplanung als solche exakt die vom Sachverständigen festgestellte regelwidrige und damit mangelhafte Einbauweise vorgesehen hat.*)
4. Bei den anerkannten technischen Regeln widersprechenden Werkleistungen zum Einbau von hochwertigen (thermisch-getrennten) Fensterelementen reichen Vermutungen des Werkunternehmers nicht aus, die Kondensatbildung an der Innenseite der Fensterelemente könne auch möglichweise auf irgendwelchen sonstigen (auftraggeberseitigen) Einflüssen beruhen, die jedes (d. h. auch ordnungsgemäß eingebaute) Fenster in gleicher Weise innen "schwitzen" lassen würden.*)
5. Die Freigabe bzw. Freizeichnung einer vom Werkunternehmer vertraglich geschuldeten Werkstatt- und Montageplanung durch den Architekten des Bauherrn stellt sich nicht als eigene Planungsleistung des Architekten dar, sondern als eine Architektenleistung im Rahmen der Bauüberwachung/-betreuung, die der gewährleistungspflichtige Werkunternehmer dem Bauherrn grundsätzlich nicht als Mitverschulden i.S.v. §§ 254, 278 BGB entgegenhalten kann.*)
6. Ein primär leistungspflichtiger Werkunternehmer kann sich (im Rahmen seiner primären werkvertraglichen Pflicht zur Vorlage einer Werkstatt- und Montageplanung) zudem jedenfalls nicht mit Erfolg auf ein Mitverschulden des Architekten (§ 254 BGB) dahingehend stützen, der Architekt habe seinen (sekundären) Kontrollpflichten bei der Freigabe/Freizeichnung der von ihm primär geschuldeten Detail-/Anbindungs- /Anschlussplanung zur Montage der Aluminiumelement nicht genügt. Insoweit greift der Grundsatz ein, dass sich im Rahmen von § 254 BGB (bzw. § 426 BGB) der (Gesamt-)Schuldner, der seinerseits eine eigenständige primäre Vertragspflicht verletzt hat, nicht mit Erfolg darauf berufen kann, in der Erfüllung eben dieser Pflicht durch einen anderen etwaigen mitverantwortlichen (Gesamt-)Schuldner nicht genügend überwacht worden zu sein.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1292
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.01.2020 - 22 U 244/19
1. Bei einer sog. "unechten" Baukosten/-summengarantie ist zur Ermittlung von etwaigen Ansprüchen des Bauherrn in einem ersten Schritt - und zwar sowohl leistungs- als auch vergütungsbezogen - der genaue Umfang der für die garantierte Bausumme zu erbringenden (und damit die Garantie "konstituierenden") Leistungen (unter Abgrenzung von etwaigen Eigenleistungen) festzustellen.*)
2. In einem zweiten Schritt sind dann - für exakt dieses der ("unechten") Garantie vertraglich zu Grunde gelegte Leistungsprogramm bzw. unter Abgrenzung von davon abweichenden Mehr- bzw. Minderleistungen - die tatsächlich entstandenen Zahlungsverpflichtungen bzw. Zahlungen/Kosten des Bauherrn zu ermitteln, d. h. aus den Angeboten, Abschlags- und Schlussrechnungen der beteiligten Handwerker bzw. sonstigen Belegen zu entnehmen.*)
3. Ungeachtet der Frage, ob es sich bei den Ansprüchen des Bauherrn aus einer Garantie um Erfüllungs- oder Nichterfüllungsansprüche handelt, trägt er als Anspruchsteller grundsätzlich die Darlegungs- bzw. Beweislast für die Voraussetzungen des von ihm geltend gemachten Anspruchs, wobei seine Darlegungslast indes ggf. durch eine sekundäre Darlegungslast des Auftragnehmers verkürzt sein kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1289
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.03.2020 - 22 U 222/19
1. Ein Urteil, mit dem die Aufrechnung des Werkunternehmers mit einer Restwerklohnforderung gegen die Klage des Auftraggebers auf Erstattung von überzahlten Abschlagszahlungen nur mangels (vorrangig zu prüfender) Prüfbarkeit seiner Schlussrechnung zurückgewiesen wird, entfaltet infolge der entsprechenden Ausführungen des Erstgerichts in den Urteilsgründen nur eingeschränkte Rechtskraft dahingehend, dass dem beklagten Werkunternehmer die spätere aktive Geltendmachung seiner (dann ggf. erstmals prüffähig abgerechneten und damit fälligen) Restwerklohnforderung vorbehalten bleibt.*)
2. Nur für den Fall, dass das Erstgericht einen Aufrechnungseinwand berücksichtigt, ihn aber - nach den Entscheidungsgründen - deswegen für erfolglos hält, weil das zugrunde liegende Vorbringen unsubstantiiert (i.S.v. unschlüssig bzw. unerheblich) bzw. unbegründet sei, kann die vom Erstgericht aberkannte Forderung wegen § 322 Abs. 2 ZPO nicht mehr anderweitig gerichtlich geltend gemacht werden.*)
3. Zu den erbrachten Werkleistungen bei einem vorzeitig beendeten Werkvertrag gehören grundsätzlich nur diejenigen Arbeiten, die sich im Zeitpunkt der Kündigung des Werkvertrags bereits im Bauwerk verkörpern. Demzufolge gehören zu den erbrachten Leistungen grundsätzlich nicht die bereits hergestellten bzw. gelieferten, aber noch nicht eingebauten Bauteile, unabhängig davon, ob sie bereits zur Baustelle geliefert wurden oder nicht.*)
4. Bei der Abrechnung eines vorzeitig beendeten (Detail-)Pauschalvertrags obliegt die Anwendung des materiellen Rechts (einschließlich der Grundsätze der diesbezüglichen Rechtsprechung des BGH) ausschließlich dem Gericht ("jura novit curia", vgl. § 17 Abs. 2 Satz 1 GVG) und der Auftragnehmer hat - auch im Lichte der Dispositionsmaxime im Zivilprozess - keine "Ausschaltungs- /Ausschließungsbefugnis" dahingehend, das Gericht möge seinen Vergütungsanspruch nur (ausschnittsweise) beschränkt auf von ihm genannte Materialpreise prüfen und dürfe von ihm nicht die Vorlage einer Vor-/Ur- Gesamtkalkulation bzw. die Erstellung einer entsprechenden Nach- /Gesamtkalkulation fordern.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1160
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 14.11.2017 - 5 U 42/17
1. Der Unternehmer kann ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags bis zur vollständigen Befriedigung der von § 648a BGB a.F. (§ 650f BGB) erfassten Ansprüche vom Besteller die Stellung einer Bauhandwerkersicherheit verlangen.
2. Das Verlangen einer Bauhandwerkersicherheit ist nur bei grobem Rechtsmissbrauch ausgeschlossen (hier verneint).
3. Wird der Besteller unter Vorschlag von Abnahmeterminen zur Abnahme aufgefordert wird und entsendet er zum Termin einen mit der Sache befassten Architekten, muss er sich dessen rechtsgeschäftliche Erklärungen im Wege der Anscheinsvollmacht zurechnen lassen.
IBRRS 2020, 1156
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 20.09.2017 - 5 U 42/17
1. Der Unternehmer kann ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags bis zur vollständigen Befriedigung der von § 648a BGB a.F. (§ 650f BGB) erfassten Ansprüche vom Besteller die Stellung einer Bauhandwerkersicherheit verlangen.
2. Das Verlangen einer Bauhandwerkersicherheit ist nur bei grobem Rechtsmissbrauch ausgeschlossen (hier verneint).
3. Wird der Besteller unter Vorschlag von Abnahmeterminen zur Abnahme aufgefordert wird und entsendet er zum Termin einen mit der Sache befassten Architekten, muss er sich dessen rechtsgeschäftliche Erklärungen im Wege der Anscheinsvollmacht zurechnen lassen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1216
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 11.10.2018 - 5 U 40/18
1. Bei einem Vertrag über die Lieferung und die Montage einer Dach-Photovoltaikanlage handelt es sich um einen (Bau-)Werkvertrag.
2. Eine angeblich fehlerhafte Auftragsbestätigung stellt nicht per se den vorherigen mündlichen Vertragsschluss zur Disposition.
3. Erklärt der Auftraggeber die Kündigung des Bauvertrags aus wichtigem Grund, ist die Kündigungserklärung in der Regel dahin zu verstehen, dass auch eine freie Kündigung gewollt ist (BGH, IBR 2003, 595).
4. Das Schweigen des Auftraggebers auf eine Fristsetzung des Auftragnehmers kann eine schwerwiegende Vertragsverletzung darstellen, die den Auftragnehmer zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund berechtigt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1199
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG München, Urteil vom 28.01.2020 - 28 U 452/19
1. Ein Vertrag über die Lieferung und die Montage einer Photovoltaikanlage stellt einen Werkvertrag dar, wenn Planung und Lieferung aufwendig sind und auch nach Abschluss der Arbeiten der Erfolg erst nach einer gewissen Zeitdauer und eines "Probelaufs" überprüfbar ist.
2. Die Bezeichnung eines Vertrags als "Kaufvertrag" ist für dessen rechtliche Qualifikation unerheblich, weil die Zuordnung eines Rechtsgeschäfts zu den gesetzlichen Vertragstypen nicht wirksam vereinbart werden kann.
3. Bieter der Unternehmer eine "schlüsselfertige" Photovoltaikanlage an, hat er eine vollständige und funktionstaugliche Anlage zu errichten. Denn der Begriff "schlüsselfertig" suggeriert, dass der Besteller nur noch den Schlüssel "umdrehen" muss, um die Sache in Gebrauch zu nehmen und zu nutzen.
4. Wird die Fertigstellung einer Photovoltaikanlage zu einem bestimmten Zeitpunkt "garantiert", ist das für den Ersatz von Verzögerungsschäden grundsätzlich erforderliche Verschulden keine Voraussetzung für die Geltendmachung eines Verzögerungsschadens.
IBRRS 2020, 1183
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Bremen, Urteil vom 14.02.2020 - 4 O 1372/12
Mit Zimmerer- und Innenausbauarbeiten einerseits bzw. mit Dachdeckerarbeiten andererseits beauftragte Werkunternehmer haften für unterlassene Prüf- und Hinweispflichten bei erkennbaren Spuren von Schädlingsbefall im Dachstuhl (hier: Fraßspuren eines Holzbocks).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1214
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Beschluss vom 29.05.2017 - 22 U 379/17
1. Wird ein Pauschalpreisvertrag gekündigt, kann die Höhe der Vergütung nur nach dem Verhältnis des Werts der erbrachten Teilleistung zum Wert der nach dem Pauschalvertrag geschuldeten Gesamtleistung errechnet werden.
2. Der Auftragnehmer muss die bereits erbrachten Leistungen und die dafür anzusetzende Vergütung darlegen und von dem nicht ausgeführten Teil abgrenzen; dazu gehört, dass er das Verhältnis der bewirkten Leistungen zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes für die Teilleistungen zum Pauschalpreis darstellt.
3. Hat der Auftragnehmer keine Urkalkulation erstellt, muss er diese nicht nachträglich anfertigen, sondern kann ein Gutachten zum Bautenstand einzuholen, mit dem das Verhältnis der bewirkten Leistungen zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes für die Teilleistungen zum Pauschalpreis ermittelt wird.
4. Die fünfjährige Verjährungsfrist für Baumängel ist nicht zwingend an die Abnahme der Leistung geknüpft. Die Verjährung beginnt auch dann, wenn der Auftraggeber die Entgegennahme des Werks als Erfüllung der Vertragsleistung ablehnt, indem er die Abnahme endgültig verweigert.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1097
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Beschluss vom 05.09.2017 - 22 U 379/17
1. Wird ein Pauschalpreisvertrag gekündigt, kann die Höhe der Vergütung nur nach dem Verhältnis des Werts der erbrachten Teilleistung zum Wert der nach dem Pauschalvertrag geschuldeten Gesamtleistung errechnet werden.
2. Der Auftragnehmer muss die bereits erbrachten Leistungen und die dafür anzusetzende Vergütung darlegen und von dem nicht ausgeführten Teil abgrenzen; dazu gehört, dass er das Verhältnis der bewirkten Leistungen zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes für die Teilleistungen zum Pauschalpreis darstellt.
3. Hat der Auftragnehmer keine Urkalkulation erstellt, muss er diese nicht nachträglich anfertigen, sondern kann ein Gutachten zum Bautenstand einzuholen, mit dem das Verhältnis der bewirkten Leistungen zur vereinbarten Gesamtleistung und des Preisansatzes für die Teilleistungen zum Pauschalpreis ermittelt wird.
4. Die fünfjährige Verjährungsfrist für Baumängel ist nicht zwingend an die Abnahme der Leistung geknüpft. Die Verjährung beginnt auch dann, wenn der Auftraggeber die Entgegennahme des Werks als Erfüllung der Vertragsleistung ablehnt, indem er die Abnahme endgültig verweigert.
IBRRS 2020, 1087
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Urteil vom 16.05.2017 - 6 U 4/17
1. Die Kündigung eines Bauvertrags ist in der Regel dahin zu verstehen, dass auch eine freie Kündigung gewollt ist (BGH, IBR 2003, 595).
2. Welche Anforderungen an die Abrechnung des gekündigten Bauvertrags zu stellen sind, hängt vom Vertrag sowie den seinem Abschluss und seiner Entwicklung zu Grunde liegenden Umständen ab. Sie ergeben sich daraus, welche Angaben der Auftraggeber zur Wahrung seines Interesses an sachgerechter Verteidigung benötigt.
3. Der Auftragnehmer muss über die kalkulatorischen Grundlagen der Abrechnung so viel vortragen, dass dem für höhere ersparte Aufwendungen darlegungs- und beweisbelasteten Auftraggeber eine sachgerechte Rechtswahrung möglich wird.
4. Führt der Auftragnehmer nachvollziehbar aus, dass und warum er keine Füllaufträge angenommen hat und keine Füllaufträge vorgelegen haben, muss der Auftraggeber, der dies für unzutreffend hält und meint, Füllaufträge hätten vorgelegen, dies konkret vortragen und hierzu Beweis anbieten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1081
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamburg, Urteil vom 25.09.2019 - 4 U 26/18
1. Der bauleitende Architekt ist nicht dazu berechtigt, für den Auftraggeber die Abnahme der Leistung zu erklären. Etwas anderes gilt, wenn er hierzu ausdrücklich bevollmächtigt wurde oder der Auftraggeber sich die Mitwirkung des Architekten an der Abnahme nach den Grundsätzen der Anscheins- oder Duldungsvollmacht zurechnen lassen muss.
2. Die Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, wonach "zusätzliche Leistungen nur nach schriftlich erteiltem Auftrag bezahlt werden", benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen und ist unwirksam (BGH, IBR 2005, 1).
3. Eine auftragslos erbrachte Leistung wird vom Auftraggeber dadurch (schlüssig) anerkannt, dass er von der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer Kenntnis hat und sie widerspruchslos entgegennimmt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1033
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Stuttgart, Urteil vom 17.10.2017 - 10 U 55/17
1. Für Abdichtungsarbeiten an Dach, Becken und Fußboden eines Hallenbads kann auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers eine Gewährleistungsfrist von 10 Jahren wirksam vereinbart werden.
2. Wird im Abnahmeprotokoll eine andere Verjährungsfrist angegeben als im Bauvertrag vereinbart, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob es sich um eine einvernehmliche Verkürzung bzw. Verlängerung der Gewährleistungsfrist handelt oder ob lediglich ein Versehen vorliegt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1065
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 07.04.2020 - 4 U 141/19
Fordert der Auftraggeber den Auftragnehmer per E-Mail zur Abgabe eines Angebots auf und gibt der Auftragnehmer daraufhin vorbehaltlos ein Angebot ab, werden sämtliche Unterlagen Vertragsbestandteil, die der E-Mail des Auftraggebers als Anlage beigefügt waren.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1063
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 27.08.2019 - 14 U 25/19
1. Eine Erklärung, durch die eine nordrhein-westfälische Gemeinde verpflichtet werden soll, bedarf der Schriftform. Eine vom Bürgermeister lediglich mündlich abgegebene Verpflichtungserklärung ist schwebend unwirksam.
2. Die Zusage des Bürgermeisters, die Gemeinde werde die Stillstandskosten wegen des Stopps eines Gebäudeabrisses übernehmen, stellt kein Geschäft laufender Verwaltung dar und ist somit für die Gemeinde nicht verpflichtend.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1061
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Jena, Urteil vom 27.06.2019 - 8 U 874/18
Verhandeln die Parteien eines VOB/B-Vertrags über die Eignung eines bauseits zu stellenden Gerüstes als Voraussetzung für Arbeiten des Auftragnehmers und schließen die Parteien später eine Vereinbarung über dessen Beschaffenheit, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Baubeginn um den Zeitraum, der dem Vorlaufzeitraum zwischen Vertragsschluss und ursprünglichem Baubeginn entspricht. Dieser Zeitraum bleibt bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach § 6 Abs. 7 VOB/B unberücksichtigt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1032
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Schleswig, Beschluss vom 28.06.2019 - 7 U 138/18
1. Aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.02.2018 (IBR 2018, 196) kommt für alle nach dem 01.01.2002 geschlossenen Werkverträge - unerheblich ob BGB-Werkvertrag oder VOB/B-Vertrag - ein Ersatz fiktiver Mängelbeseitigungskosten nicht mehr in Betracht.
2. Eine Geschäfts- und Firmenfortführung mit der Folge eines gesetzlichen Schuldbeitritts setzt nicht unbedingt voraus, dass die Firma wort- und buchstabengetreu fortgeführt wird. Allerdings muss sich der Kern der alten und neuen Firma gleichen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0983
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 30.10.2019 - 2 U 113/18
1. Zur Abgrenzung zwischen einer Änderung der Preisermittlungsgrundlagen i.S.v. § 2 Abs. 5 VOB/B und bloßen Erschwernissen der ausgeschriebenen Leistungen.*)
2. Der öffentliche Auftraggeber kann das Risiko einer u. U. geringeren oder höheren Störkörperbelastung einer Räumparzelle dadurch zulässigerweise auf den Bieter verlagern, dass er Mengenkorridore für jede in Betracht kommende Belastungssituation ausschreibt.*)
3. Nimmt der Bieter trotz der Ausschreibung in Mengenkorridoren keine positionsbezogene Kalkulation, sondern eine Verbundkalkulation unter Berücksichtigung der oberen Kalkulationsgröße für den Vortrieb des Suchtrupps vor, so hat er das sich hieraus ergebende Vergütungsrisiko selbst zu tragen.*)
4. Der Ausgleich von Mindermengen nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B ist jeweils losweise vorzunehmen, auch wenn ein Auftragnehmer den Zuschlag im Vergabeverfahren auf mehrere Lose erhalten und seine Leistungen in einer einheitlichen Schlussrechnung abgerechnet hat.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0912
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Urteil vom 09.12.2015 - 17 U 91/14
1. Die Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten kann auch mündlich erfolgen.
2. Einem Anspruch auf Vergütung von Stundenlohnarbeiten steht die fehlende Vollmacht des Nachunternehmers für den Abschluss einer Stundenlohnvereinbarung mit dem Auftraggeber dann nicht entgegen, wenn der Auftragnehmer die Erklärung mit der Rechnungsstellung genehmigt.
3. Ein ungenehmigter Nachunternehmereinsatz berechtigt den Auftraggeber nur zur Kündigung. Die vor der Kündigung ausgeführten Leistungen hat er zu vergüten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0920
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Rostock, Urteil vom 22.11.2019 - 1 S 177/18
1. Der Auftragnehmer haftet für einen Mangel seiner Leistung auch dann, wenn die Mangelursache (auch) im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftragnehmer die ihm obliegenden Prüf- und Bedenkenhinweispflichten erfüllt hat.
2. Erklärt der Auftraggeber die Teilkündigung des Bauvertrags und hat der gekündigte Leistungsteil auf die Mangelfreiheit des verbleibenden Werks evidenten Einfluss, ist der Auftragnehmer im Rahmen der ihm auch nach Vertragsschluss weiterhin obliegenden Obhuts-, Fürsorge- und Kooperationspflichten verpflichtet, den Auftraggeber zu informieren und ihm die Möglichkeit einzuräumen, den Mangeleintritt zu verhindern.
3. Die Hemmung der Verjährung innerhalb eines selbständigen Beweisverfahrens ist zwar für jeden Mangel einzeln zu prüfen. Werden jedoch mehrere Gutachten wegen desselben Mangels eingeholt, kommt es auf den Zugang und die Erläuterung des letzten Gutachtens an.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0860
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 21.03.2019 - 2 U 21/18
Ist beiden Vertragsparteien eines Bauvertrags über ein sog. Kompletthaus, insbesondere dem Bauunternehmen, bei Vertragsschluss positiv bekannt, dass der Bauherr für die Vergütung des Bauunternehmers auf eine Fremdfinanzierung angewiesen ist und sehr hohe Risiken des Fehlschlagens einer Fremdfinanzierung bestehen, so kann der Vertrag dahin auszulegen sein, dass er - unausgesprochen - unter der aufschiebenden Bedingung einer erfolgreichen Finanzierung steht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0784
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Hamm, Urteil vom 07.12.2017 - 17 U 187/15
1. Erklärt der Auftraggeber die Kündigung des Bauvertrags, wird der Werklohnanspruch des Auftragnehmers nur fällig, wenn die Leistung entweder abgenommen wurde oder ein Abrechnungsverhältnis vorliegt (hier verneint).
2. Verlangt der Auftraggeber nach Kündigung des Bauvertrags weiterhin die Beseitigung von (wesentlichen) Mängeln, liegt in der Aufforderung, die Schlussrechnung zu übersenden, keine (konkludente) Abnahmeerklärung.
3. Die Möglichkeit einer fiktiven Abnahme ist ausgeschlossen, wenn eine förmliche Abnahme vereinbart wurde.
4. Ändern sich in dem Zeitraum zwischen Ausführung der Arbeiten und der Abnahme die allgemein anerkannten Regeln der Technik, schuldet der Auftragnehmer die Vertragsdurchführung nach Maßgabe der zur Zeit der Abnahme geltenden Regeln.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0829
 Bauvertrag
Bauvertrag
BGH, Urteil vom 30.01.2020 - VII ZR 33/19
§ 642 BGB erfordert eine Abwägungsentscheidung des Tatrichters auf der Grundlage der in § 642 Abs. 2 BGB genannten Kriterien. Dabei ist die angemessene Entschädigung im Ausgangspunkt an den auf die unproduktiv bereitgehaltenen Produktionsmittel entfallenden Vergütungsanteilen einschließlich der Anteile für allgemeine Geschäftskosten sowie für Wagnis und Gewinn zu orientieren.*)
IBRRS 2020, 0490
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 22.06.2018 - 7 U 111/17
1. Verlangt der Auftraggeber die Ausführung geänderter oder zusätzlicher Leistungen und enthält das Nachtragsangebot des Auftragnehmers keinen Hinweis auf bauzeitbedingte Mehrkosten, kann er diese nicht (mehr) geltend machen, wenn der Auftraggeber das Angebot vorbehaltlos annimmt ("kein Nachtrag zum Nachtrag").
2. Die Anordnung geänderter oder zusätzlicher Leistungen ist weder eine unterlassene Mitwirkungshandlung des Auftraggebers noch eine von ihm zu vertretende Vertragsverletzung.
3. Gibt der Auftraggeber aufgrund einer Bauzeitverzögerung neue Vertragstermine vor und erklärt sich der Auftragnehmer mit diesen einverstanden, liegt eine "andere Anordnung des Auftraggebers" vor, so dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Mehrvergütung zusteht.
4. Für die Sicherung eines Mehrvergütungsanspruchs aufgrund einer bauzeitlichen Anordnung kann der Auftragnehmer die Stellung einer Bauhandwerkersicherung gem. § 648a BGB a.F. (§ 650f BGB) verlangen.
5. Mit der Vorlage eines substantiierten baubetrieblichen Gutachtens wird der zu sichernde Anspruch des Auftragnehmers der Höhe nach schlüssig dargelegt.
IBRRS 2020, 0687
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Frankfurt, Urteil vom 26.11.2018 - 29 U 91/17
1. Versäumt es der Auftraggeber, fristgerecht Einwände gegen die Prüfbarkeit der Schlussrechnung geltend zu machen, wird die Schlusszahlung - ungeachtet der fehlenden Prüfbarkeit der Schlussrechnung - mit Ablauf der Prüffrist fällig.
2. Durch die Erteilung einer neuen Schlussrechnung wird die - bereits eingetretene - Fälligkeit der Schlusszahlung nicht wieder aufgehoben und beseitigt.
3. Hat der Auftragnehmer bei einem gekündigten Pauschalpreisvertrag prüfbar abgerechnet, ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe die geltend gemachte Werklohnforderung berechtigt ist. Auch wenn die Rügefrist versäumt wird, muss das Gericht die Richtigkeit der Schlussrechnung sachlich prüfen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0706
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 01.02.2018 - 5 U 78/17
Vergleichen sich die Parteien eines Bauvertrags dahingehend, dass der Auftragnehmer den von ihm eingebauten Lift "TÜV-abgenommen" übergibt, erfüllt die vorgelegte Bescheinigung einer privaten Prüfgesellschaft nicht die Voraussetzungen des Vergleichs.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 3843
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 04.02.2020 - 23 U 127/19
1. Die Frage, ob die Mängelbeseitigung auf einem kostengünstigeren Wege möglich ist, muss grundsätzlich bereits im Rechtsstreit über den Vorschuss aufgeklärt werden.
2. Kommen zwei verschiedene Möglichkeiten der Mängelbeseitigung in Betracht, die beide geeignet sind, den vertraglichen Erfolg herbeizuführen, ist für den Kostenvorschussanspruch die günstigste Mängelbeseitigungsmethode zugrunde zu legen. Das gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die kostengünstigere Methode zumutbar und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit realisierbar ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0562
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Nürnberg, Urteil vom 27.04.2017 - 13 U 2051/15
1. Die Rechtsfolgen einer Kündigung können nach dem Zeitpunkt ihres Zugangs weder einseitig widerrufen noch zurückgenommen werden. Allerdings haben die Parteien die Möglichkeit, den Eintritt der Rechtsfolgen einer bereits wirksam gewordenen Kündigung durch einverständliche Vereinbarung aufzuheben bzw. zu beseitigen.
2. Erfolgt diese Vereinbarung vor dem Zeitpunkt, zu dem der Vertrag nach Erklärung der Kündigung enden soll, wird der ursprüngliche Vertrag als solcher fortgesetzt.
3. Kommt eine Einigung über eine "Rücknahme" der Kündigungswirkungen erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zustande, führt diese zur Begründung eines neuen Vertragsverhältnisses, wenn auch in der Regel mit dem Inhalt des früheren Vertrags.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0332
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Stuttgart, Urteil vom 31.01.2017 - 10 U 70/16
1. Die Kündigungstatbestände der VOB/B sind nicht abschließend. Über die in den §§ 8 und 9 VOB/B geregelten Fälle hinaus können beide Vertragsparteien den Bauvertrag kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des anderen Vertragspartners der Vertragszweck so gefährdet ist, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.
2. Die Kündigung eines Bauvertrags aus wichtigem Grund ist grundsätzlich erst zulässig, wenn der andere Vertragsteil nachdrücklich und unmissverständlich auf die Folgen einer weiteren Nichterfüllung der Vertragspflichten hingewiesen worden ist.
3. Einer Fristsetzung mit Kündigungsandrohung bzw. einer Abmahnung bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn entweder eine solche Nachfristsetzung bzw. Androhung von vornherein keinen Erfolg verspricht oder sich das Verhalten des Kündigungsgegners als eine besonders schwere Vertragsverletzung darstellt, die es dem Kündigenden unzumutbar macht, noch weiterhin mit diesem Partner im Vertrag zu bleiben bzw. den Ablauf einer durch die Abmahnung eröffneten, noch weiteren Zeitspanne abzuwarten.
4. Die unberechtigte Verweigerung der Bezahlung von Abschlagsrechnungen kann einen Grund zur fristlosen Kündigung darstellen. Steht aber nur ein geringer Betrag zur Zahlung offen, ist der Auftragnehmer gehalten, sich vor einer fristlosen Kündigung um eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts zu bemühen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0568
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Stuttgart, Urteil vom 26.06.2017 - 10 U 139/16
1. Die erfolglose Aufforderung an den Auftragnehmer, innerhalb einer gesetzten Frist seine Bereitschaft zur Mängelbeseitigung zu erklären, berechtigt den Auftraggeber nicht dazu, den Bauvertrag zu kündigen. Vielmehr ist bei umfangreichen, zeitlich schwer abzuschätzenden Mängelbeseitigungsmaßnahmen zumindest eine Frist für den Nachbesserungsbeginn zu setzen (Anschluss an OLG Stuttgart, IBR 2010, 326).
2. Eine unwirksame außerordentliche Kündigung ist im Regelfall als freie Kündigung auszulegen (Anschluss an BGH, IBR 2003, 595).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0034
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 13.07.2018 - 16 U 30/18
1. Sind ein Bauunternehmer und ein Bauträger bei einem vor Erlass des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 22.08.2013 (IBR 2014, 49) geschlossenen Bauvertrags übereinstimmend von der Steuerschuldnerschaft des Bauträgers ausgegangen und hat dieser die auf die erbrachten Bauleistungen entfallende Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt, hat der Bauunternehmer gegen den Bauträger einen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer, wenn diese dem Bauträger vom Finanzamt erstattet wurde.
2. Die ergänzende Vertragsauslegung hat Vorrang vor den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0091
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Urteil vom 11.04.2018 - 16 U 140/12
1. Eine Bauleistung ist mangelhaft, wenn die tatsächliche (Ist-)Beschaffenheit von der vereinbarten, vertraglich vorausgesetzten, gewöhnlichen oder üblichen (Soll-)Beschaffenheit negativ abweicht.
2. Ein Mangel liegt bereits dann vor, wenn der begründete Verdacht einer Gesundheitsgefährdung bzw. eine Ungewissheit über die Risiken des Gebrauchs eines Gebäudes besteht.
3. Der Mangel der auf einer nicht auszuschließenden Gesundheitsgefährdung beruhenden Unbewohnbarkeit eines Gebäudes führt dazu, dass sich der Werklohn für die Sanierungsarbeiten auf Null mindert und der Auftragnehmer auf Schadensersatz haftet.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0638
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Oldenburg, Urteil vom 19.03.2019 - 2 U 46/17
1. Die Frage, welche Vergütung bzw. Miete für den Aufbau und die Vorhaltung eines Baugerüsts zu zahlen ist, ist unabhängig von der rechtlichen Einordnung des Vertrags zu beantworten.
2. Entgegen der Abrechnung der Vorhaltezeiten bei anderen Gerüstarten, bei denen nach angefangenen Wochen zu rechnen ist, ist für Traggerüste eine Abrechnung nach Kalendertagen anerkannt.
3. Das allgemeinsprachliche Verständnis eines Begriffs ist dann nicht von Bedeutung, wenn die verwendete Formulierung von den angesprochenen Fachleuten in einem spezifisch technischen Sinn verstanden wird oder wenn für bestimmte Aussagen Bezeichnungen verwendet werden, die in den maßgeblichen Fachkreisen verkehrsüblich sind oder für deren Verständnis und Verwendung es gebräuchliche technische Regeln wie z. B. DIN-Normen gibt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0612
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 15.01.2020 - 2-20 O 2/20
1. Erklärt der Auftraggeber die außerordentliche Kündigung eines VOB-Bauvertrags, kann er für die Weiterführung der Arbeiten u.a. die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers in Anspruch nehmen.
2. Erforderlich, aber auch ausreichend ist die Mitteilung des Auftraggebers, dass er die Baustelleneinrichtung gegen Entgelt weiter nutzen will. Einer Einigung über die Vergütungshöhe bedarf es nicht.
3. Ein Streit zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber über die Höhe der Vergütung bzw. darüber, ob diese schon beglichen ist, führt nicht dazu, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber die weitere Verwendung seiner auf die Baustelle verbrachten Gegenstände verbieten kann.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0755
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Berlin, Urteil vom 17.04.2018 - 58 O 70/17
1. Obliegen Planung und Ausführung der gesamten Fußbodenheizung mit Ausnahme des Küchenheizkreises allein dem Auftraggeber, muss der Auftragnehmer nach Beauftragung der Zusatzleistung "Beheizung Küche" den Auftraggeber nicht über die Erforderlichkeit einer Umlegung der Zuführungen beraten, um so den Küchenboden individuell beheizen zu können.
2. Bringt die mit einem Aufwand von ca. 40.000 Euro verbundene Mängelbeseitigung dem Auftraggeber keinen nennenswerten oder spürbaren Nutzen, ist sie unverhältnismäßig, wenn der Auftragswert der Zusatzleistung lediglich 200 Euro beträgt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0323
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Naumburg, Urteil vom 30.08.2018 - 2 U 1/18
1. Eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist entbehrlich, wenn eine Gefahrensituation besteht und der Auftragnehmer trotz erkennbarer Eilbedürftigkeit den Mangel nicht behebt, obwohl er hierzu in der Lage ist.
2. Zu den nach der Beseitigung des Mangels erstattungsfähigen Aufwendungen gehören alle mit der Mangelbehebung im Zusammenhang stehende Arbeiten und Maßnahmen. Sie sind nicht auf die Kosten in Höhe des Verkehrswerts der mangelfreien Leistung beschränkt.
3. Eine sog. Ohne-Rechnung-Abrede in Bezug auf andere als die vertragsgegenständlichen Leistungen führt nicht dazu, dass der Auftraggeber keine Mängelansprüche geltend machen kann.
4. Hat der Auftragnehmer seine Leistung mangelhaft erbracht, handelt er treuwidrig, wenn er sich zur Abwehr von Mängelansprüchen des Auftraggebers darauf beruft, die Gesetzeswidrigkeit der "Ohne-Rechnung-Abrede" führe zur Gesamtnichtigkeit des Bauvertrags (Anschluss an BGH, IBR 2008, 431).
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0565
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Brandenburg, Urteil vom 21.03.2018 - 11 U 124/15
1. Vor einer Kündigung des Bauvertrags wegen Mängeln bzw. der Geltendmachung von Mängelrechten hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung einzuräumen.
2. Ob eine Frist zur Mängelbeseitigung angemessen ist, bestimmt sich objektiv nach Art und Umfang der erforderlichen Arbeiten. Hinsichtlich ihrer Länge kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, wobei auf den Zeitaufwand eines tüchtigen und sorgfältigen Auftragnehmers abzustellen ist.
3. Zu berücksichtigen ist auch, dass eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich ist, damit der Auftragnehmer alles Organisatorische veranlassen kann und dass sonstige äußere Umstände eine Rolle spielen können.
4. Ein Nachunternehmer kann nicht einfach das Grundstück des Bauherrn betreten, dort seine Gerätschaften abstellen und mit den Mängelbeseitigungsarbeiten beginnen. Die erforderlichen Einwilligungen zu beschaffen, obliegt vielmehr dem Auftraggeber.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0489
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 27.02.2019 - 7 U 227/18
1. Die in der VOB/B mehrfach zu findende Formulierung "in sich abgeschlossener Teil der Leistung" ist einheitlich auszulegen, auch wenn sie in verschiedenen Regelungen (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 und § 12 Abs. 2 VOB/B) verwendet wird (Anschluss an BGH, IBR 2009, 570).
2. Leistungsteile innerhalb eines Gewerks (hier: Arbeiten an einzelnen Wänden und Geschossdecken eines Gebäudes) können nicht als in sich abgeschlossen angesehen werden.
3. Wird eine Bauzeit von "ca. einem Jahr" angegeben, muss der Auftragnehmer eine Bauzeitverlängerung in der Größenordnung von 10 % (fünf bis sechs Wochen) einkalkulieren.
4. Hat es der Auftraggeber versäumt, verbindliche Vertragsfristen zu vereinbaren, kann er eine Kündigung nicht auf die Regelung des § 5 Abs. 4 VOB/B (Kündigung wegen Verzugs mit der Vollendung) stützen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 2690
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Köln, Beschluss vom 17.05.2018 - 16 U 105/17
Zur Arglist und Organisationspflichtverletzung als Voraussetzung einer verlängerten Verjährung der Mängelansprüche nach § 634a BGB bei der Bauwerkerstellung durch einen Generalunternehmer.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0485
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Nürnberg, Beschluss vom 16.10.2018 - 2 U 2188/17
1. Soll der Auftragnehmer im Rahmen einer Straßenerneuerung nach den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses die zu entfernende Frostschutzschicht "verwerten", kann er nicht davon ausgehen, dass das Material der Frostschutzschicht wiederverwendbar ist.
2. Voraussetzung für einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung wegen einer anders als vereinbart ausgeführten Leistung ist, dass der Auftraggeber die Leistungsänderung angeordnet hat (hier verneint).
3. Setzt sich der Auftraggeber mit den Nachtragsforderungen des Auftragnehmers auseinander, liegt darin kein Anerkenntnis auftragslos erbrachter (Zusatz-)Leistungen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0484
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Nürnberg, Beschluss vom 10.08.2018 - 2 U 2188/17
1. Soll der Auftragnehmer im Rahmen einer Straßenerneuerung nach den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses die zu entfernenden Frostschutzschicht "verwerten", kann er nicht davon ausgehen, dass das Material der Frostschutzschicht wiederverwendbar ist.
2. Voraussetzung für einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung wegen einer anders als vereinbart ausgeführten Leistung ist, dass der Auftraggeber die Leistungsänderung angeordnet hat (hier verneint).
3. Setzt sich der Auftraggeber mit den Nachtragsforderungen des Auftragnehmers auseinander, liegt darin kein Anerkenntnis einer auftragslos ausgeführten (Zusatz-)Leistung.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0435
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 14.02.2019 - 27 U 64/18
1. Obliegen Planung und Ausführung der gesamten Fußbodenheizung mit Ausnahme des Küchenheizkreises allein dem Auftraggeber, muss der Auftragnehmer nach Beauftragung der Zusatzleistung "Beheizung Küche" den Auftraggeber nicht über die Erforderlichkeit einer Umlegung der Zuführungen beraten, um so den Küchenboden individuell beheizen zu können.
2. Bringt die mit einem Aufwand von ca. 40.000 Euro verbundene Mängelbeseitigung dem Auftraggeber keinen nennenswerten oder spürbaren Nutzen, ist sie unverhältnismäßig, wenn der Auftragswert der Zusatzleistung lediglich 200 Euro beträgt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0398
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG München I, Urteil vom 18.09.2019 - 11 O 9751/18
Eine schriftliche Mängelrüge nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B verlängert die Mängelverjährungsfrist bezüglich solcher Mängel nicht, die sich der Auftraggeber bei Abnahme bereits vorbehalten hat.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0389
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.01.2020 - 21 U 34/19
Das Gericht kann auch ohne dass sich eine Vertragspartei darauf beruft feststellen, dass eine zur Nichtigkeit des Werkvertrags führende Schwarzgeldabrede getroffen worden ist. Die Überzeugung von einer solchen (stillschweigend) zu Stande gekommenen Schwarzgeldvereinbarung kann sich aus der Auswertung schriftlichen Kommunikation zwischen den Parteien (hier: per WhatsApp) ergeben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0257
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Dresden, Urteil vom 15.01.2019 - 6 U 1326/18
1. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Mehrvergütung wegen der Ausführung einer geänderten Leistung (§ 2 Abs. 5 VOB/B) setzt neben einer Anordnung des Auftraggebers (§ 1 Abs. 3 VOB/B) eine Abweichung zwischen der Leistungsbeschreibung (Bau-Soll) und der tatsächlich ausgeführten Leistung (Bau-Ist) voraus (hier verneint).
2. Hat der Auftragnehmer vertraglich das Risiko der Verwertung des überschüssigen Bodens übernommen, kann er keine Preisanpassung verlangen, wenn es zu einer - auch erheblichen - Mengenüberschreitung kommt.
3. In einem VOB/B-Einheitspreisvertrag scheidet ein Anspruch auf Vertragsanpassung wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage bei Mengenabweichungen aus.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0190
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Celle, Urteil vom 30.04.2019 - 7 U 282/18
1. Die Abnahme kann auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen und damit auch zugleich auf eine vereinbarte förmliche Abnahme konkludent verzichtet werden.
2. Eine konkludente Abnahme liegt jedoch nur vor, wenn dem nach Außen hervortretenden Verhalten des Auftraggebers eindeutig zu entnehmen ist, dass er die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht billigt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0087
 Bauvertrag
Bauvertrag
LG Karlsruhe, Urteil vom 20.12.2019 - 10 O 365/17
Der Besteller kann einen Werkvertrag bis zur Abnahme kündigen. Ein Anspruch auf Erstattung von Restfertigstellungskosten besteht nur, wenn dem Unternehmer zuvor eine angemessene Frist gesetzt wurde. Ein Baustellenverbot kann dies unmöglich machen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0238
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 23.02.2017 - 6 U 150/16
1. Der Auftraggeber hat im VOB-Pauschalpreisvertrag einen Anspruch auf Preisanpassung, wenn er Änderungen des Bauentwurfs anordnet oder andere Anordnungen trifft, die zu Minderleistungen führen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Festhalten an der Pauschalsumme zumutbar ist oder nicht.
2. Erspart der Auftragnehmer durch eine geänderte Planung Aufwendungen, hat er diese in Form einer Preisreduktion an den Auftraggeber weiterzureichen.
3. Auch wenn die Leistung nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht, kann der Auftraggeber keine Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn die Ist-Beschaffenheit aus technischer Sicht qualitativ höherwertiger ist als die vorgesehene Soll-Beschaffenheit.