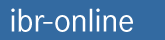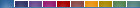Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
1447 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2022
IBRRS 2022, 1839 Handelsrecht
Handelsrecht
AG Düsseldorf, Urteil vom 18.06.2021 - 37 C 755/19
1. Die öffentlich-rechtliche Marktentgeltordnung der Stadt D. ist als AGB der privatrechtlichen Marktnutzungsverträge mit den einzelnen Marktteilnehmern anzusehen.*)
2. Die Umlage der Kosten für auf dem Marktgelände wild abgelagerten Abfall auf die einzelnen Marktteilnehmer ist AGBrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden. Es wird aber weder § 1 Abs. 1 der Marktentgeltordnung noch dem betriebskostenrechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot Rechnung getragen, wenn die Ablagerung von wildem Abfall derart ineffektiv unterbunden wird, dass wild abgelagerter Abfall 33% bis 50% der gesamten Abfallmenge des Marktes ausmacht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2022, 1068
 Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsrecht
BGH, Beschluss vom 25.01.2022 - II ZB 15/21
Die einer Firma vorangestellten Sonderzeichen "//" sind nicht zu ihrer Kennzeichnung geeignet.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2022, 0679
 Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 13.01.2022 - III ZR 210/20
Weist eine Unternehmergesellschaft i.S.v. § 5a GmbHG nicht - wie im Gesetz vorgesehen - ihre Rechtsform und die Haftungsbeschränkung in der Firma aus, haftet ihr im Rechtsverkehr auftretender Vertreter für den dadurch erzeugten unrichtigen Rechtsschein gem. § 311 Abs. 2, 3, § 179 BGB analog (Anschluss an BGH, IBR 2012, 674).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2022, 0468
 Handelsrecht
Handelsrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 04.12.2020 - 19 U 198/19
(ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
Online seit 2021
IBRRS 2021, 3399 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 19.10.2021 - 26 U 49/19
1. Wird eine Sache zu einem ermäßigten Sonderpreis verkauft, führt dies nicht ohne Weiteres dazu, dass der Käufer mit einer minderwertigen Qualität und einem Ausschluss der Gewährleistungshaftung des Verkäufers rechnen muss.*)
2. § 193 BGB ist auf die Mängelrüge nach § 377 Abs. 3 HGB entsprechend anzuwenden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 2189
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Beschluss vom 15.06.2021 - II ZB 25/17
Die Anmeldung einer Eintragung in das Handelsregister ist gem. § 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 HGB mit einem einfachen elektronischen Zeugnis eines Notars gem. § 39a BeurkG elektronisch einzureichen. Die Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Ausstellers der Anmeldung gem. § 126a BGB reicht nicht aus.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 1853
 Handelsrecht
Handelsrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 22.01.2020 - 7 U 95/18
(ohne amtliche Leitsätze)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 1086
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Brandenburg, Beschluss vom 30.01.2020 - 7 W 51/17
1. Betriebe der öffentlichen Hand sind den kaufmännisch geführten Gewerbebetrieben zuzuordnen, wenn sich der öffentlich-rechtliche Rechtsträger wie ein Privatunternehmen am Geschäftsverkehr beteiligt.
2. Ein Zweckverband betreibt jedenfalls dann keinen Gewerbebetrieb, wenn er seine Leistungen nicht in privatrechtlichen Verträgen vereinbart, sondern sich ausschließlich hoheitlicher, öffentlich-rechtlich bestimmter Handlungsformen bedient.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 0126
 Pacht
Pacht
LG Bonn, Urteil vom 11.12.2020 - 1 O 194/19
Die Dokumentation der Geschäftsvorfälle in den Handelsbüchern ist zwar kein Anscheinsbeweis für die inhaltliche Richtigkeit der Handelsbücher als Privaturkunde, es spricht aber eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der dort vorgenommenen Einträge.
 Volltext
Volltext
Online seit 2020
IBRRS 2020, 1561 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Beschluss vom 28.04.2020 - II ZB 13/19
Eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) kann mit "gUG (haftungsbeschränkt)" eingetragen werden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1574
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18.05.2020 - 5 W 18/20
ohne amtlichen Leitsatz
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0400
 Grundbuchrecht
Grundbuchrecht
OLG München, Beschluss vom 07.01.2020 - 34 Wx 420/19
Die Berichtigung des durch den Tod eines Gesellschafters bürgerlichen Rechts unrichtig gewordenen Grundbuchs setzt neben dem Nachweis des Versterbens eines bisherigen Gesellschafters und des Nachweises der Erbfolge einen Nachweis des Inhalts des Gesellschaftsvertrags voraus. Wurde dieser privatschriftlich errichtet, kann die Vorlage dieses nicht der grundbuchrechtlichen Form entsprechenden Gesellschaftsvertrags genügen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2019
IBRRS 2019, 3303 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 21.03.2018 - 1 U 22/16
(kein amtlicher Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 3180
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Frankfurt, Beschluss vom 17.07.2017 - 13 U 172/16
ohne amtlichen Leitsatz
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 3107
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
KG, Beschluss vom 10.07.2019 - 2 W 16/19
1. Entsprechend der Rechtslage bei § 67 Abs. 2 AktG steht auch einem zu Unrecht nicht in die Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafter einer GmbH ein Anspruch auf Einreichung einer korrigierten Gesellschafterliste zu, den er im Wege der Leistungsklage gegen die Gesellschaft durchsetzen kann.*)
2. Ein solcher Anspruch besteht auch dann, wenn der tatsächlich eingetragene Scheingesellschafter der Einreichung einer korrigierten Gesellschafterliste widerspricht. Der Berechtigte muss sich nicht darauf verweisen lassen, die Rechtslage zunächst in einem Rechtsstreit mit dem eingetragenen Listengesellschafter (Prätendentenstreit) zu klären.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 2854
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 20.02.2019 - R 28/15
1. Der Vertrag zwischen einer Gesellschaft und ihrem Gesellschafter, mit dem ein Anspruch des Gesellschafters auf Übereignung eines Grundstücks begründet wird, unterliegt nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer.
2. Die Bemessungsgrundlage richtet sich nach dem Wert der Gegenleistung und nicht nach dem Grundbesitzwert, wenn der Erwerb des Gesellschafters nicht zu Rechtsänderungen der Gesellschafterstellung führt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 2843
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Koblenz, Urteil vom 27.06.2019 - 1 U 1405/18
1. Werden von einem Softwaredienstleister an einen Programmierer den Programmierer der Software für den Support und die Aktualisierung der Software Vorschüsse geleistet, die zur teilweisen Verrechnung auf die dem Programmierer zustehenden Umsatzprovisionen bestimmt sind, sind diese Vorschüsse rechtlich als Darlehen zu qualifizieren. Vorschüsse sind in Abgrenzung zu Abschlagszahlungen Geldleistungen auf einen noch nicht verdienten Lohn. (Rn. 33) *)
2. Ein Vorschuss kommt dabei in wirtschaftlicher Hinsicht einem kurzfristigen Darlehen. Eine Zahlung ist nur dann ein Vorschuss, wenn sich beide Vertragsparteien darüber einig sind, dass es sich um einen Vorschuss handelt, der bei Fälligkeit der Forderung verrechnet wird. Dabei sind Vorschüsse und Abschlagszahlungen nicht nach der gewählten Bezeichnung, sondern nach objektiven Merkmalen zu unterscheiden. Im Bereich des Arbeits- und Dienstvertragsrecht ist eine Darlehenshingabe in der Regel dann anzunehmen, wenn der gewährte Betrag die Gehaltshöhe wesentlich übersteigt und zu einem Zweck gegeben wird, der mit den normalen Bezügen nicht oder nicht sofort erreicht werden kann und zu dessen Befriedigung auch sonst üblicherweise Kredite in Anspruch genommen werden. Dagegen handelt es sich um einen Gehaltsvorschuss, wenn die demnächst fällige Gehaltszahlung für kurze Zeit vorverlegt wird, damit der Arbeitnehmer bis dahin seinen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 08.07.1968 - III ZR 48/67, zitiert nach jurion). (Rn. 33) *)
3. Vorschüsse und Abschlagszahlungen sind nicht nach der gewählten Bezeichnung, sondern nach objektiven Merkmalen zu unterscheiden. Im Bereich des Arbeits- und Dienstvertragsrecht ist eine Darlehenshingabe in der Regel dann anzunehmen, wenn der gewährte Betrag die Gehaltshöhe wesentlich übersteigt und zu einem Zweck gegeben wird, der mit den normalen Bezügen nicht oder nicht sofort erreicht werden kann und zu dessen Befriedigung auch sonst üblicherweise Kredite in Anspruch genommen werden. Dagegen handelt es sich um einen Gehaltsvorschuss, wenn die demnächst fällige Gehaltszahlung für kurze Zeit vorverlegt wird, damit der Arbeitnehmer bis dahin seinen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann. (Rn. 33) *)
4. Derjenige, der einen Vorschuss annimmt, muss diesen zurückzahlen, wenn und soweit eine bevorschusste Forderung nicht entsteht (in Anknüpfung an BAG, Urteil vom 20.06.1989 - 3 AZR 504/87; Urteil vom 10.03.1960 - 5 AZR 426/58; Urteil vom 11.07.1961 - 3 AZR 216/60; Urteil vom 16.02.1962 - 5 AZR 211/61; Urteil vom 28.06.1965 - 3 AZR 86/65; OLG Frankfurt, Urteil vom 17.09.2008 - 23 U 137/07). (Rn. 36) *)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 2233
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Stuttgart, Urteil vom 21.03.2019 - 14 U 26/16
1. Auch ein umfassendes gesellschaftsvertragliches Konkurrenzverbot für einen Minderheitsgesellschafter unterliegt einer Abwägung mit der grundgesetzlich geschützten Berufsausübungsfreiheit. Es ist jedenfalls dann unwirksam, wenn der Minderheitsgesellschafter sein Anstellungsverhältnis als leitender Mitarbeiter der Gesellschaft vor Ablauf der für das Gesellschaftsverhältnis satzungsrechtlich vorgesehenen Kündigungsfrist wirksam beendet hat und eine fortbestehende Gefahr der "Aushöhlung" der Gesellschaft nicht feststellbar ist.*)
2. Für einen Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der sog. "Geschäftschancenlehre" bei Planungsleistungen für öffentliche Auftraggeber bedarf es besonderer Darlegungen, um die behaupteten Folgeprojekte als der Gesellschaft zugeordnet schlüssig annehmen zu können. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Beauftragung (bislang) nur auf einzelne Leistungsphasen beschränkt erfolgte und (Folge-)Aufträge in Anwendung öffentlicher Vergaberegeln zur Erhaltung des Wettbewerbs vergeben wurden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0967
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Hamm, Urteil vom 23.02.2017 - 18 U 101/16
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0606
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Schleswig, Urteil vom 06.07.2017 - 16 U 93/16
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
Online seit 2018
IBRRS 2018, 3980 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Hamburg, Beschluss vom 25.06.2018 - 11 U 13/18
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 3852
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Karlsruhe, Urteil vom 08.08.2017 - 13 U 155/15
1. Ob ein Handelsvertretervertrag vorliegt, entscheidend sich allein danach, ob bei Berücksichtigung aller sich aus der Zusammenarbeit der Parteien ergebender Einzelkriterien der Schwerpunkt des sich ergebenden Bildes auf handelsrechtlichem Gebiet liegt.
2. Ein Provisionsanspruch entsteht nach § 87 Abs. 1 1. Alt. HGB für Geschäfte, bei deren Abschluss die Tätigkeit des Handelsvertreters mitursächlich war.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 3026
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.05.2017 - 16 U 61/16
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 2730
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Hamburg, Urteil vom 17.05.2017 - 8 U 59/16
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 4275
 Handelsrecht
Handelsrecht
OLG München, Urteil vom 14.02.2018 - 7 U 675/16
1. Ein gegenseitiger Vertrag ist nichtig bei einem auffälligen Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung, wenn weitere Umstände hinzutreten, die das Verdikt der Sittenwidrigkeit rechtfertigen, insbesondere eine verwerfliche Gesinnung der einen Seite oder die Ausbeutung der schwierigen Lage oder Unerfahrenheit der anderen Seite für das eigene unangemessene Gewinnstreben.
2. Ist das Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung besonders grob, besteht eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen von verwerflicher Gesinnung; bei einem zwar nicht besonders groben, aber doch auffälligen Missverhältnis besteht diese Vermutung nicht, sondern der Geschädigte muss Umstände für das Vorliegen von verwerflicher Gesinnung dartun und gegebenenfalls beweisen.
3. Ausgangspunkt für das Verdikt der Sittenwidrigkeit ist also jedenfalls zunächst ein (grobes oder doch auffälliges) Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, welches derjenige darzulegen hat, welcher sich auf Sittenwidrigkeit beruft, also hier der Beklagte.
4. Das Vorliegen eines solchen Missverhältnisses bestimmt sich durch einen Vergleich der Werte von Leistung und Gegenleistung. Dabei ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise angezeigt. Maßgeblich ist der Preis, der der zu bewertenden Leistung üblicherweise im sonstigen Geschäftsverkehr zukommt, also der marktübliche Preis.
5. ein eventuell "überhöhter" Gewinn der einen Seite des gegenseitigen Vertrages rechtfertigt den Vorwurf der Sittenwidrigkeit für sich gesehen nicht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 1976
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Dresden, Beschluss vom 14.12.2017 - 8 U 1433/17
1. Satzungsbestimmungen einer Genossenschaft, nach denen die Auszahlung eines Auseindersetzungsguthabens ein Mindestkapital der Genossenschaft voraussetzt, sind auf Grund der Entscheidungen des Gesetzgebers (§ 8a GenG und § 73 Abs. 2 Satz 2 GenG) wirksam, auch wenn dies zu einer letztlich unbefristeten Auszahlungssperre zu Lasten des ausscheidenden Mitglieds führen kann. Das Genossenschaftsmitglied wird im Fall einer erstmaligen Verankerung eines Mindestkapitals in der Satzung durch § 67a GenG hinreichend geschützt.*)
2. § 8a GenG und § 73 Abs. 2 Satz 2 GenG sind auch anwendbar, wenn das Ausscheiden des Genossenschaftsmitgliedes nicht auf einer ordentlichen Kündigung beruht, sondern auf Grund einer außerordentlichen Kündigung oder eines Widerrufs nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft erfolgt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 1210
 Prozessuales
Prozessuales
OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.03.2018 - 11 U 35/17
1. Die von der Rechtsprechung zur gesetzlichen Vertretung bei der Prozessführung (§ 51 ZPO) entwickelten Grundsätze kommen auch dann zur Anwendung, wenn die wirksame Vertretung einer Aktiengesellschaft durch einen von der Hauptversammlung bestellten besonderen Vertreter (§ 147 AktG) in Streit steht.*)
2. Der Geltendmachungsbeschluss nach § 147 AktG muss die zu verfolgenden Ansprüche konkretisieren. Es ist insoweit nicht Aufgabe des besonderen Vertreters, die Voraussetzungen nur möglicher, allein nach der Anspruchsgrundlage bezeichneter Ersatzansprüche erst festzustellen. Hierfür sieht das Gesetz die Sonderprüfung vor.*)
3. Die Geltendmachung von Ansprüchen der Gesellschaft gegen Aktionäre (allein) wegen zu Unrecht ausbezahlter Dividenden, insbesondere aus § 62 AktG, kann die Hauptversammlung nicht nach § 147 AktG beschließen. Ein gleichwohl gefasster Beschluss ist in diesem Punkt nichtig (§ 241 Nr. 3 AktG).
4. Bei der Anwendung von § 139 BGB auf teilweise nichtige Geltendmachungsbeschlüsse der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ist für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens der Hauptversammlung zu berücksichtigen, ob ein ursprünglich bestehendes Stimmverbot bei einer gedachten Abstimmung nur über die nicht unmittelbar fehlerbehafteten Teile entfiele.*)
5. Ein wegen zu Unrecht ausbezahlter Dividenden in Anspruch genommener (Mehrheits-)Aktionär ist von der isolierten Abstimmung über deswegen geltend zu machende Ansprüche gegen Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nicht ausgeschlossen, wenn die anspruchsbegründenden Pflichtverletzungen verschiedener Natur sind.*)
6. Ist der Beschluss über die Bestellung eines besonderen Vertreters nichtig, so ist eine von diesem im Namen der Gesellschaft erhobene Klage aus prozessualen Gründen abzuweisen, wenn nicht die originär zuständigen Organe das Verfahren aufnehmen und die Prozessführung des besonderen Vertreters genehmigen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 1149
 Rechtsanwälte
Rechtsanwälte
OLG Frankfurt, Gerichtlicher Hinweis vom 16.11.2017 - 3 U 176/15
1. Nach der Beendigung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts steht dem einzelnen Gesellschafter für zurückliegende Zeiträume kein vertraglicher Anspruch auf seinen Gewinnanteil mehr zu, sondern nur noch ein Anspruch auf seinen Anteil am Auseinandersetzungsguthaben. Etwas anderes gilt nicht schon dann, wenn sich die Auseinandersetzung wegen der Unnachgiebigkeit der Gesellschafter lange hinzieht.*)
2. Ein nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in erster Instanz eingehender Schriftsatz, mit dem geänderte Anträge angekündigt werden, ist in der Berufungsinstanz nach § 533 ZPO zu behandeln und verliert bei einer Beschlussentscheidung nach § 522 Abs. 2 ZPO analog § 524 Abs. 4 ZPO seine Wirkung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 1147
 Rechtsanwälte
Rechtsanwälte
OLG Frankfurt, Beschluss vom 15.02.2018 - 3 U 176/15
1. Nach der Beendigung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts steht dem einzelnen Gesellschafter für zurückliegende Zeiträume kein vertraglicher Anspruch auf seinen Gewinnanteil mehr zu, sondern nur noch ein Anspruch auf seinen Anteil am Auseinandersetzungsguthaben. Etwas anderes gilt nicht schon dann, wenn sich die Auseinandersetzung wegen der Unnachgiebigkeit der Gesellschafter lange hinzieht.*)
2. Ein nach Schluss der letzten mündlichen Verhandlung in erster Instanz eingehender Schriftsatz, mit dem geänderte Anträge angekündigt werden, ist in der Berufungsinstanz nach § 533 ZPO zu behandeln und verliert bei einer Beschlussentscheidung nach § 522 Abs. 2 ZPO analog § 524 Abs. 4 ZPO seine Wirkung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 0388
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 17.05.2017 - II R 35/15
1. Ein Gesellschafter ist neu i.S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG, wenn er zivilrechtlich erstmals ein Mitgliedschaftsrecht an einer bestehenden grundbesitzenden Personengesellschaft erwirbt oder wenn er innerhalb von fünf Jahren nach dem erstmaligen Erwerb des Mitgliedschaftsrechts seine Beteiligung durch den Erwerb weiterer Anteile am Gesellschaftsvermögen aufstockt. Er verliert grunderwerbsteuerrechtlich die Eigenschaft als neuer Gesellschafter erst mit Ablauf von fünf Jahren.*)
2. Die Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a GrEStG erfasst auch die Aufstockung der Beteiligungsquote eines neuen Gesellschafters.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2017
IBRRS 2017, 3924 Immobilien
Immobilien
OLG Hamm, Beschluss vom 28.03.2017 - 15 W 109/17
Ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht, das ursprünglich für eine BGB-Gesellschaft begründet worden ist, besteht bei Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile auf einen Gesellschafter für diesen als alleinigen Berechtigten fort.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3886
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 17.10.2017 - KZR 24/15
1. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister kann ein Mangel der Form der Übernahmeerklärung nicht mehr mit Erfolg gerügt werden.*)
2. Der Verstoß eines Rechtsgeschäfts gegen das Vollzugsverbot führte auch unter der Geltung von § 41 Abs. 1 GWB in der Fassung der 7. GWB-Novelle nicht zu dessen Nichtigkeit, sondern nur zur schwebenden Unwirksamkeit.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3466
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Dresden, Urteil vom 25.08.2016 - 8 U 347/16
1. Zum Anspruch des Gesellschafters auf Zulassung eines Vertreters/Begleiters zur Gesellschafterversammlung einer GmbH.*)
2. Zur Erzwingung der Teilnahme des Vertreters/Begleiters im Wege einer einstweiligen Verfügung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2531
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Hamm, Urteil vom 23.06.2017 - 12 U 103/16
1. Ob die Haftsumme des Kommanditisten gedeckt ist, entscheidet sich allein nach der Bilanz mit fortgeführten Buchwerten, so dass der in Anspruch genommene Kommanditist auch nur mittels der Bilanzen beweisen kann, dass seine Haftsumme gedeckt ist.*)
2. Die Verjährung der Haftung sowohl des Kommanditisten als auch des Kommanditisten-Treugebers richtet sich nach den Vorschriften der §§ 159, 160, 161 Abs. 2 HGB.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0143
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Beschluss vom 21.07.2016 - IV R 26/14
Dem Großen Senat des BFH wird gemäß § 11 Abs. 2 FGO folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: Ist einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden Gesellschaft die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auch dann nicht zu gewähren, wenn sie an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist?*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0071
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
LG Duisburg, Urteil vom 09.11.2016 - 25 O 54/12
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
Online seit 2016
IBRRS 2016, 3156 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 01.12.2015 - IX R 42/14
1. Sog. "nachträgliche Schuldzinsen" können auch nach einer nicht steuerbaren Veräußerung einer zur Vermietung bestimmten Immobilie grundsätzlich weiter als Werbungskosten abgezogen werden, wenn und soweit die Darlehensverbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden können.*)
2. Die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung steht unter dem Vorbehalt der vorrangigen Schuldentilgung.*)
3. Für die Berücksichtigung von nachträglichem Zinsaufwand als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es nicht von Bedeutung, dass dieser nicht aufgrund der ursprünglichen darlehensvertraglichen Verpflichtung (oder einer damit einhergehenden vertraglichen Haftung), sondern aufgrund einer gesetzlich geregelten Gesellschafterhaftung geleistet wurde.*)
4. Die Entscheidung des Steuerpflichtigen, seine Beteiligung an einer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielenden Personengesellschaft zu veräußern, beinhaltet grundsätzlich den Entschluss, die Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung aufzugeben. Unbeschadet dessen führt eine Inanspruchnahme im Zuge der Nachhaftung (§ 736 Abs. 2 BGB i.V.m. § 160 HGB) bei einem Steuerpflichtigen, der seine Beteiligung an der GbR gerade zur Vermeidung einer solchen persönlichen Haftung weiterveräußert hat, zu berücksichtigungsfähigem Aufwand, soweit er diesen endgültig selbst trägt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 3013
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, vom 20.09.2016 - II ZR 120/15
Wird eine (hier: mehrgliedrige atypisch) stille Gesellschaft aufgelöst, sind die stillen Gesellschafter zur Rückzahlung der ihnen zugeflossenen gewinnunabhängigen Ausschüttungen an den Geschäftsinhaber verpflichtet, wenn dieser Rückzahlungsanspruch im Gesellschaftsvertrag geregelt ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 3005
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Urteil vom 27.09.2016 - II ZR 299/15
Die formalen Anforderungen einer erneuten Aufforderung mittels eingeschriebenen Briefs gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GmbHG werden durch ein Einwurf-Einschreiben der Deutschen Post AG gewahrt.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2508
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 07.04.2016 - I ZR 81/15
1. Eine gesundheitsbezogene Angabe ist als (spezielle) gesundheitsbezogene Angabe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 anzusehen, wenn damit ein einem wissenschaftlichen Nachweis zugänglicher Wirkungszusammenhang zwischen einem Nährstoff, einer Substanz, einem Lebensmittel oder einer Lebensmittelkategorie einerseits und einer konkreten Körperfunktion andererseits hergestellt wird. Es ist unerheblich, wenn die Angabe dazu kein medizinisches, sondern ein umgangssprachliches Vokabular verwendet.*)
2. Eine gesundheitsbezogene Angabe, die von den angesprochenen Verkehrskreisen dahin verstanden wird, ein bestimmtes Produkt könne Schäden an Haut, Haaren oder Fingernägeln beseitigen, ist mit den nach der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben, ein bestimmter Nährstoff trage zur Erhaltung normaler Haut, Haare oder Nägel bei, nicht inhaltsgleich und daher unzulässig.*)
3. Eine gesundheitsbezogene Angabe, die nicht erkennen lässt, auf welchen der in der Liste der zugelassenen Angaben im Anhang zur Verordnung (EU) Nr. 432/2012 aufgeführten Nährstoffen, Substanzen, Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien die behauptete Wirkung eines Produkts beruht, ist mit den zugelassenen Angaben nicht inhaltsgleich und daher unzulässig.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2507
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 05.04.2016 - II ZR 268/14
1. Ein Unternehmen erfüllt seine Mitteilungspflicht nach § 20 Abs. 1, 4 AktG nur dann ordnungsgemäß mit der Folge, dass § 20 Abs. 7 AktG die Ausübung der Rechte aus den Aktien nicht ausschließt, wenn die Gesellschaft nicht korrigierend eingreifen muss, vielmehr die Beteiligung und deren Inhaber, wie sie ihr mitgeteilt worden sind, bekannt machen kann, ohne dass in der Öffentlichkeit Zweifel entstehen, welche Art Beteiligung gemeint und wem sie zuzurechnen ist (Bestätigung von BGH, 22.04.1991 - II ZR 231/90, BGHZ 114, 203).*)
2. Aus dem auf die Publikation nach § 20 Abs. 6 AktG ausgerichteten Zweck der Mitteilungspflichten nach § 20 AktG ergibt sich, dass die schriftliche Mitteilung nach Form und Inhalt darauf ausgerichtet sein muss, von dem Vorstand der Aktiengesellschaft als Mitteilung im Sinne von § 20 AktG erfasst zu werden.*)
3. Eine bereits vor dem Erwerb der Beteiligung erfolgte Mitteilung ist zur Erfüllung der Mitteilungspflicht grundsätzlich nicht geeignet.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2143
 Gesellschaftsrecht
Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 12.07.2016 - II ZR 74/14
Der Abfindungsanspruch des aus einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts Ausgeschiedenen richtet sich umfassend gegen die Gesellschaft. Für einen von dem Abfindungsanspruch zu trennenden Ausgleichsanspruch gegen die in der Gesellschaft verbliebenen Gesellschafter ist kein Raum.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2083
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Hamm, Urteil vom 13.01.2016 - 8 U 115/15
Zahlungsansprüche zwischen einer GbR und einem aus der Gesellschaft ausgeschiedenen früheren Gesellschafter sind grds. nicht mehr isoliert durchsetzbar, sondern sind als unselbständige Rechnungsposten in die Abfindungsrechnung aufzunehmen. Dies hat zur Folge, dass einzelne Forderungen, die der Durchsetzungssperre unterliegen, ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters nicht mehr abgetreten werden können.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2062
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
BGH, Urteil vom 14.07.2016 - VII ZR 297/15
Eine Vertragsbestimmung in einem Handelsvertretervertrag, wonach ein Teil der dem Handelsvertreter laufend zu zahlenden Vergütung auf den künftigen Ausgleichsanspruch angerechnet werden soll, verstößt im Zweifel gegen die zwingende Vorschrift des § 89b Abs. 4 Satz 1 HGB und ist daher in der Regel gemäß § 134 BGB nichtig. Eine solche Vertragsbestimmung ist nur dann rechtswirksam, wenn sich feststellen lässt, dass die Parteien auch ohne die Anrechnungsabrede keine höhere Provision vereinbart hätten, als dem Teil der Gesamtvergütung entspricht, der nach Abzug des abredegemäß auf den Ausgleichsanspruch anzurechnenden Teils verbleibt. Die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzung vorliegt, trifft den Unternehmer. Ist eine derartige Vertragsbestimmung hiernach nichtig, so ist der zur Anrechnung vorgesehene Teil der Vergütung als vom Unternehmer geschuldeter Teil der Gesamtvergütung anzusehen (Anschluss an BGH, 13.01.1972 - VII ZR 81/70, BGHZ 58, 60).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1859
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 25.11.2015 - II R 35/14
Erwirbt ein Miterbe bei der Erbauseinandersetzung einen zum Nachlass gehörenden Anteil an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft und führt dieser Erwerb nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG zu einer Vereinigung von Anteilen an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, ist die Anteilsvereinigung nicht nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1603
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 18.02.2016 - V R 23/15
1. Wird ein von einer GmbH bebautes Grundstück teilweise dem Geschäftsführer zu Wohnzwecken überlassen, so scheidet ein Vorsteuerabzug für den Wohnteil gemäß § 15 Abs. 2 UStG aus, wenn dieser steuerfrei vermietet wurde.*)
2. Das Recht zur Nutzung zu Wohnzwecken aufgrund des Arbeitsvertrags des Geschäftsführers kann Teilentgelt für seine Arbeitsleistung darstellen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1602
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 25.11.2015 - II R 18/14
Der Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personengesellschaft ändert sich i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG mittelbar, wenn ein an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligter Gesellschafter mit einem oder mehreren Treugebern vereinbart, den Gesellschaftsanteil treuhänderisch für diese zu halten, und die Treuhandvereinbarungen im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum dazu führen, dass den Treugebern mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft als neuen Gesellschaftern zuzurechnen sind.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1572
 Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
OLG Köln, Urteil vom 20.12.2013 - 19 U 16/13
(ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1467
 Steuerrecht
Steuerrecht
BFH, Urteil vom 20.08.2015 - IV R 26/13
Die tätigkeitsbezogene und rechtsformneutrale Befreiung der Betriebskapitalgesellschaft von der Gewerbesteuer nach § 3 Nr. 20 b GewStG erstreckt sich bei einer Betriebsaufspaltung auch auf die Vermietungs- oder Verpachtungstätigkeit der Besitzpersonengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1441
 Grundbuchrecht
Grundbuchrecht
KG, Beschluss vom 29.03.2016 - 1 W 907/15
Für die Grundbuchberichtigung nach dem Tod eines im Grundbuch eingetragenen GbR-Gesellschafters bedarf es keiner Vorlage des Gesellschaftsvertrags, wenn die Erbfolge in der Form des § 35 GBO nachgewiesen ist und sowohl die Erben als auch die weiteren im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter die Berichtigung gemäß §§ 19, 29 Abs. 1 S. 1 GBO bewilligen.*)
 Volltext
Volltext