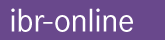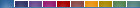Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
160 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2022
IBRRS 2022, 0682 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Bonn, Urteil vom 19.01.2022 - 20 O 191/20
1. Ein Rücktritt von einem Kaufvertrag wegen mangelhafter Leistungen setzt grundsätzlich voraus, dass eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde und erfolglos verstrichen ist. Die Fristsetzung ist ausnahmsweise u. a. dann entbehrlich, wenn die Parteien ein absolutes Fixgeschäft geschlossen haben.
2. Ein sog. absolutes Fixgeschäft liegt vor, wenn bei der Nichteinhaltung der Leistungszeit bei wertender Betrachtung Unmöglichkeit eintritt, weil die Leistungszeit so wesentlich ist, dass eine verspätete Leistung keine Erfüllung mehr sein kann (z.B. Bestellungen für bestimmte Veranstaltungen, die danach nie mehr benötigt werden). Bei einem absoluten Fixgeschäft greifen die Regelungen über die Unmöglichkeit ein.
4. Bei einem "relativen" Fixgeschäft muss die Einhaltung der Leistungszeit so wesentlich sein, dass mit der zeitgerechten Leistung das Geschäft "stehen und fallen" soll.
5. Ob ein Fixgeschäft vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Der Fixcharakter einer Lieferfrist im Kaufrecht kann nicht wirksam in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2022, 0639
 Immobilien
Immobilien
BGH, Urteil vom 19.11.2021 - V ZR 104/20
Weist die Kaufsache einen behebbaren Mangel auf, ist der Käufer grundsätzlich selbst dann berechtigt, gemäß § 320 Abs. 1 BGB die Zahlung des Kaufpreises insgesamt zu verweigern, wenn es sich um einen geringfügigen Mangel handelt (Bestätigung von Senat, IBR 2020, 318).*)
Online seit 2021
IBRRS 2021, 3678 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12.11.2021 - 10 U 11/21
Wer im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Kaufvertrags eine Wissenserklärung oder Wissensmitteilung abgibt, haftet dafür, dass das eigene subjektive Wissen richtig und vollständig wiedergeben wird, nicht aber dafür, dass das subjektive Wissen auch den objektiven Gegebenheiten entspricht. Eine "fahrlässig falsche Wissenserklärung" gibt es nicht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 3517
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.02.2021 - 22 U 262/20
1. Will der Erwerber einer Einbauküche von einem Verbrauchsgüterkauf wegen Verzugs des Verkäufers zurücktreten, ist keine ausdrückliche Fristsetzung erforderlich. Es genügt eine Leistungsaufforderung und das Abwarten einer angemessenen Frist. Jedenfalls ist es ausreichend, wenn der Erwerber deutlich macht, dass dem Verkäufer nur ein begrenzter Zeitraum für die (Nach-)Erfüllung zur Verfügung steht.
2. Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers einer Einbauküche, wonach der Kaufpreis "zahlbar sofort ohne Abzug" ist, benachteiligt den Käufer unangemessen und ist unwirksam (Anschluss an BGH, IBR 2013, 379).
3. Die Verwendung einer (erkennbar) unwirksamen Allgemeinen Geschäftsbedingung ist eine Vertragspflichtverletzung. Der Käufer hat daher einen Anspruch so gestellt zu werden, als hätte der Verkäufer die unwirksame Klausel nicht verwendet.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 3399
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 19.10.2021 - 26 U 49/19
1. Wird eine Sache zu einem ermäßigten Sonderpreis verkauft, führt dies nicht ohne Weiteres dazu, dass der Käufer mit einer minderwertigen Qualität und einem Ausschluss der Gewährleistungshaftung des Verkäufers rechnen muss.*)
2. § 193 BGB ist auf die Mängelrüge nach § 377 Abs. 3 HGB entsprechend anzuwenden.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 2446
 Immobilien
Immobilien
OLG Bamberg, Beschluss vom 22.06.2021 - 1 U 494/20
1. Wird der Benachteiligte vor Vertragsabschluss anwaltlich beraten, liegt keine Sittenwidrigkeit vor.
2. Wenn Parteien auf Wertgutachten vertrauen und dies der Kaufpreisfindung zu Grunde legen, kann von Ausnutzen (§ 138 Abs. 1 BGB) keine Rede sein.
3. Wer nach sofortiger Kaufpreiszahlung sein befristetes Rückkaufsrecht nicht ausübt und sich dennoch auf § 138 BGB beruft, handelt (selbst) sittenwidrig.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 2432
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Schleswig, Urteil vom 25.03.2021 - 6 U 48/20
Beim Verkauf von Wintergartenbausätzen zur Selbstmontage, die nach den individuellen Maßen und Besonderheiten des Aufstellortes gefertigt werden und dadurch nicht für andere Gebäude verwendet werden können, besteht gem. § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB kein Widerrufsrecht des Verbrauchers.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 1754
 Baukaufrecht
Baukaufrecht
BGH, Urteil vom 07.04.2021 - VIII ZR 191/19
1. Schließt eine natürliche Person ein Rechtsgeschäft objektiv zu einem Zweck ab, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, so kommt eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsgeschäftlichen Handeln objektiv verfolgten privaten Zweck nur dann in Betracht, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig und zweifelsfrei darauf hinweisen, dass die natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Bestätigung von Senatsurteile, IBR 2009, 1382 - nur online; vom 13.03.2013 - VIII ZR 186/12, Rz. 28, IBRRS 2013, 1507 = NJW 2013, 2107).*)
2. Zu den Voraussetzungen eines im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs in Betracht kommenden Anspruchs des Verbrauchers auf einen Kostenvorschuss für noch nicht angefallene Kosten des Ausbaus einer mangelhaften Kaufsache und des Einbaus einer als Ersatz gelieferten Sache (Bestätigung von Senatsurteil vom 21.12.2011 - VIII ZR 70/08, Rz. 27, 35, 53 f., IBRRS 2012, 0713 = BGHZ 192, 148).*)
3. Ein Anspruch des Käufers auf Vorschuss für die Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache besteht nicht (Bestätigung von Senatsurteil vom 21.12.2011 - VIII ZR 70/08, Rz. 49 f., a.a.O.).*)
IBRRS 2021, 1082
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Bonn, Urteil vom 17.03.2021 - 1 O 244/20
1. Eine Fristsetzung zur Nacherfüllung ist entbehrlich, wenn der Verkäufer die Leistung (hier: die mangelfreie Lieferung der vereinbarten Masken) nicht bis zu einem im Vertrag bestimmten Termin bewirkt hat, obwohl die termin- oder fristgerechte Leistung in einer für den Verkäufer erkennbaren Weise für den Käufer wesentlich ist.
2. Einem bestehenden Fixschuldcharakter kann es zwar abträglich sein, wenn die festgelegte Lieferfrist von den Vertragsparteien nachträglich einvernehmlich verlängert wird. Aus den Umständen des Einzelfalls kann sich aber ausnahmsweise auch ergeben, dass sich abgesehen von der Terminverschiebung am Fixcharakter des Geschäfts nichts ändern soll.
3. Die öffentliche Hand betreibt kein Handelsgewerbe, wenn sie - auch als Großabnehmer - nachfragt, so dass sie auch keine kaufmännischen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten trifft.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 1116
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 12.03.2021 - V ZR 33/19
Der kaufvertragliche Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (kleiner Schadensersatz) gemäß § 437 Nr. 3, §§ 280, 281 BGB kann anhand der voraussichtlich erforderlichen, aber (noch) nicht aufgewendeten ("fiktiven") Mängelbeseitigungskosten bemessen werden (Abgrenzung zu BGH, IBR 2018, 196, und IBR 2020, 636). Allerdings muss die Umsatzsteuer nur ersetzt werden, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.*)
IBRRS 2021, 0592
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 20.01.2021 - 17 U 492/19
1. Gemäß § 29 ZPO besteht für Ansprüche im Zusammenhang mit dem Widerruf und der Rückabwicklung eines Darlehensvertrags, der mit einem Pkw-Kauf ein verbundenes Geschäft darstellt, ein einheitlicher Erfüllungsort am Ort, an dem sich die veräußerte Sache vertragsgemäß befindet.*)
2. Sind Ansprüche mit unterschiedlichen Erfüllungsorten mittels einer innerprozessualen Bedingung voneinander abhängig gemacht, hindert die Klammerwirkung der Bedingung eine Abtrennung der bedingten Ansprüche.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 0523
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Saarbrücken, Urteil vom 22.01.2021 - 13 S 130/20
Lässt der Käufer sein mangelhaftes Fahrzeug zur Werkstatt des Verkäufers überführen, weil dieser das Fahrzeug selbst überprüfen und den Mangel beseitigen will, kann er die dazu erforderlichen Transportkosten vom Verkäufer gem. § 439 Abs. 2 BGB auch dann ersetzt verlangen, wenn jener angesichts der großen Entfernung zum Ort, an dem sich der Mangel gezeigt hat, einen erbetenen Vorschuss für die Transportkosten verweigert hat.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 0516
 Prozessuales
Prozessuales
LG Frankfurt/Main, Beschluss vom 14.01.2021 - 14 O 327/20
1. Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.
2. Besteht danach eine Zuständigkeit am Wohnsitz des Käufers, ist der käuferische Wohnsitz bei Vertragsschluss ausschlaggebend. Der Wohnsitz im Zeitpunkt der Klageerhebung begründet keinen Gerichtsstand.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 0509
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 02.02.2021 - VI ZR 449/20
1. Knüpft der Käufer sein Angebot auf Rückgabe der Kaufsache an eine unberechtigte Bedingung (hier: die Zahlung von Deliktszinsen seit Kaufpreiszahlung), schließt dies einen Annahmeverzug des Verkäufers aus.
2. Zur Beschränkung der Revision durch die Revisionsanträge.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2021, 0349
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG München, Beschluss vom 29.01.2021 - 20 U 820/20
1. Der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarungen stellt ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis (hier: des Käufers) dar.
2. Hat der Käufer keine unverzügliche Mängelrüge erhoben, trifft ihn die Beweislast für das Vorliegen von Mängeln.
 Volltext
Volltext
Online seit 2020
IBRRS 2020, 3750 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 18.11.2020 - VIII ZR 78/20
1. § 475 Abs. 2 letzter Halbs. BGB a.F. (= § 476 Abs. 2 letzter Halbs. BGB n.F.) verstößt gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, weil nach dieser Vorschrift entgegen Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 Verbrauchsgüterkauf-RL bei einem Kaufvertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher über gebrauchte Sachen eine Vereinbarung über die Verkürzung der Verjährungsfrist für Sachmängelgewährleistungsrechte auf weniger als zwei Jahre zugelassen wird. Die Mitgliedstaaten können nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 Verbrauchsgüterkauf-RL nur eine Vereinbarung über die Verkürzung der Haftungsdauer auf bis zu ein Jahr, nicht jedoch über die Verkürzung der Verjährungsfrist erlauben.*)
2. Eine richtlinienkonforme Anwendung von § 475 Abs. 2 letzter Halbs. BGB a.F. (= § 476 Abs. 2 letzter Halbs. BGB n.F.) dahingehend, dass diese Regelung entfällt oder nur eine Vereinbarung über die Verkürzung der Haftungsdauer erlaubt, kommt jedoch nicht in Betracht. Die Vorschrift ist vielmehr bis zu einer gesetzlichen Neuregelung weiterhin anzuwenden. Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr in Kaufverträgen über gebrauchte Sachen vorsieht, ist demnach wirksam.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 3490
 Prozessuales
Prozessuales
KG, Beschluss vom 16.11.2020 - 2 AR 1053/20
1. Bei der Rückabwicklung von Kaufverträgen über bewegliche Sachen aufgrund Rücktritt, Widerruf oder Anfechtung ist nach der unverändert geltenden Rechtsprechung ein einheitlicher Erfüllungsort und damit ein Gerichtsstand nach § 29 ZPO an dem Ort anzunehmen, an dem sich die Sache zum Zeitpunkt der Rückgängigmachung des Kaufvertrages vertragsgemäß befindet (Anschluss an BGH, Urteil vom 09.03.1983 - VIII ZR 11/82, BGHZ 87, 104; IBRRS 2011, 4387).*)
2. Der Austauchort ist auch dann für die Bestimmung des Erfüllungsorts maßgeblich, wenn die verkaufte Sache untergegangen oder bereits an den Verkäufer zurückgeben worden ist, da hierdurch Zufallsergebnisse vermieden werden und der Käufer nicht schlechter stehen sollte, als wenn der die Kaufsache behalten hätte.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 3288
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 14.08.2020 - 6 U 66/18
1. Auf einen Vertrag über die Lieferung und Montage eines Blockheizkraftwerks (BHKW) findet Kaufvertragsrecht Anwendung, wenn der Lieferanteil 2/3 des Gesamtwerts des Auftrags ausmacht und die technischen oder baulichen Anlagen des Gebäudes nicht an das BHKW angepasst oder auf ihre Eignung für den Einbau gesondert geprüft werden müssen.
2. Ein BHKW ist mangelhaft, wenn es nicht bestimmungsgemäß zur Herstellung von Energie genutzt werden kann, weil es sich entweder nicht starten lässt oder sich nach kurzer Zeit wieder abschaltet.
3. Eine (Mit-)Verantwortlichkeit des Käufers kann nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass er keinen Wartungsvertrag über die Anlage abgeschlossen hat. Denn für die Beurteilung der Verantwortlichkeit kann es nicht auf den Abschluss eines Wartungsvertrags ankommen, sondern allenfalls darauf, ob eine Wartung tatsächlich intervallweise durchgeführt worden ist.
IBRRS 2020, 3067
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 09.09.2020 - VIII ZR 150/18
1. Ein bei Gefahrübergang vorliegender, dem Alter, der Laufleistung und der Qualitätsstufe entsprechender, gewöhnlicher, die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigender Verschleiß eines für den Straßenverkehr zugelassenen Kraftfahrzeugs begründet einen Sachmangel nach § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 BGB nicht (Bestätigung der Senatsurteile vom 23.11.2005 - VIII ZR 43/05, Rz. 19, IBRRS 2006, 1923 = IMRRS 2006, 1200 = NJW 2006, 434; vom 10.10.2007 - VIII ZR 330/06, Rz. 19, IBRRS 2007, 5009 = IMRRS 2007, 2496 = NJW 2008, 53; vom 10.03.2009 - VIII ZR 34/08, Rz. 13, IBRRS 2009, 4502 = NJW 2009, 1588). Dies gilt auch dann, wenn sich daraus in absehbarer Zeit - insbesondere bei der durch Gebrauch und Zeitablauf zu erwartenden weiteren Abnutzung - ein Erneuerungsbedarf ergibt.*)
2. Die Vermutung des § 476 Halbs. 1 BGB - in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung (jetzt § 477 Halbs. 1 BGB) - entbindet den Käufer nicht davon darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, dass sich an der Kaufsache innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang ein mangelhafter Zustand (Mangelerscheinung) gezeigt hat. Der Käufer ist dann durch die genannte Vorschrift des Vortrags und des Nachweises enthoben, auf welche Ursache der zu Tage getretene mangelhafte Zustand zurückzuführen ist, sowie dass diese Ursache in den Verantwortungsbereich des Verkäufers fällt (Bestätigung der Senatsurteile vom 12.10.2016 - VIII ZR 103/15, Rz. 36, IBRRS 2016, 2880 = BGHZ 212, 224; vom 27.05.2020 - VIII ZR 315/18, IBRRS 2020, 1705 = zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen, unter II. 3. c bb (1)).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 2954
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 26.08.2020 - VIII ZR 351/19
1. Die vom Käufer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung ist nicht bereits dann gewahrt, wenn der Verkäufer innerhalb der Frist die Leistungshandlung erbracht hat; vielmehr muss auch der Leistungserfolg eingetreten sein. Die Frist ist allerdings so zu bemessen, dass der Verkäufer bei ordnungsgemäßem Vorgehen vor Fristablauf voraussichtlich nicht nur die Leistungshandlung vornehmen, sondern auch den Leistungserfolg herbeiführen kann.*)
2. Hat der Käufer eine angemessene Frist zur Nachbesserung gesetzt, die erfolglos abgelaufen ist, so ist er grundsätzlich nicht gehalten, dem Verkäufer eine zweite Gelegenheit zur Nachbesserung einzuräumen, bevor er den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. Ein zweimaliges Fehlschlagen der Nachbesserung ist nur dann Rücktrittsvoraussetzung, wenn der Käufer sein Nachbesserungsverlangen nicht mit einer Fristsetzung verbunden hat.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1897
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 09.06.2020 - VIII ZR 315/19
Ein Hersteller oder Lieferant ist nicht Erfüllungsgehilfe des Verkäufers im Rahmen seiner kaufrechtlichen Pflichten.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 1356
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 13.03.2020 - V ZR 33/19
An den VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs wird gem. § 132 Abs. 3 GVG folgende Anfrage gerichtet:
1. Wird an der in dem Urteil vom 22.02.2018 (IBR 2018, 196) vertretenen Rechtsauffassung festgehalten, wonach der "kleine" Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 280, 281 Abs. 1 BGB nicht anhand der voraussichtlich erforderlichen, aber (noch) nicht aufgewendeten ("fiktiven") Mängelbeseitigungskosten bemessen werden darf?
2. Wird ferner daran festgehalten, dass sich ein Schadensersatzanspruch des allgemeinen Leistungsstörungsrechts auf Vorfinanzierung "in Form der vorherigen Zahlung eines zweckgebundenen und abzurechnenden Betrags" richten kann (Urteil vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17, Rz. 67, IBRRS 2018, 0964)?
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0903
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG München, Urteil vom 19.02.2020 - 20 U 4108/19
Von einer Fachfirma darf erwartet werden, dass sie die bei der Bestellung verwendeten Fachbegriffe und technischen Angaben richtig einordnen kann. Sie kann sich zum Nachteil ihrer Vertragspartner nicht darauf zurückziehen, das für die Prüfung von Bestellungen erforderliche Know How schlicht nicht zu haben.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2020, 0450
 Kaufrecht
Kaufrecht
EuGH, Urteil vom 23.05.2019 - Rs. C-52/18
1. Art. 3 Abs. 3 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten für die Bestimmung des Orts zuständig bleiben, an dem der Verbraucher gemäß dieser Vorschrift dem Verkäufer ein im Fernabsatz erworbenes Verbrauchsgut für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitzustellen hat. Dieser Ort muss für eine unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen Zustands binnen einer angemessenen Frist ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher geeignet sein, wobei die Art des Verbrauchsguts sowie der Zweck, für den der Verbraucher das Verbrauchsgut benötigte, zu berücksichtigen sind. Insoweit ist das nationale Gericht verpflichtet, eine mit der Richtlinie 1999/44/EG vereinbare Auslegung vorzunehmen und gegebenenfalls auch eine gefestigte Rechtsprechung zu ändern, wenn diese auf einer Auslegung des nationalen Rechts beruht, die mit den Zielen dieser Richtlinie unvereinbar ist.*)
2. Art. 3 Abs. 2 bis 4 Richtlinie 1999/44/EG ist dahin auszulegen, dass das Recht des Verbrauchers auf eine "unentgeltliche" Herstellung des vertragsgemäßen Zustands eines im Fernabsatz erworbenen Verbrauchsguts nicht die Verpflichtung des Verkäufers umfasst, wenn das Verbrauchsgut zum Zweck der Herstellung des vertragsgemäßen Zustands an den Geschäftssitz des Verkäufers transportiert wird, einen Vorschuss auf die damit verbundenen Kosten zu leisten, sofern für den Verbraucher die Tatsache, dass er für diese Kosten in Vorleistung treten muss, keine Belastung darstellt, die ihn von der Geltendmachung seiner Rechte abhalten könnte; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.*)
3. Art. 3 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 5 zweiter Gedankenstrich Richtlinie 1999/44/EG ist dahin auszulegen, dass in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens der Verbraucher, der dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit des im Fernabsatz erworbenen Verbrauchsguts mitgeteilt hat, dessen Transport an den Geschäftssitz des Verkäufers für ihn eine erhebliche Unannehmlichkeit darstellen könnte, und der dem Verkäufer dieses Verbrauchsgut an seinem Wohnsitz zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitgestellt hat, mangels Abhilfe binnen einer angemessenen Frist die Vertragsauflösung verlangen kann, wenn der Verkäufer keinerlei angemessene Maßnahme ergriffen hat, um den vertragsgemäßen Zustand des Verbrauchsguts herzustellen, wozu auch gehört, dem Verbraucher den Ort mitzuteilen, an dem er ihm dieses Verbrauchsgut zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands bereitstellen muss. Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, anhand einer mit der Richtlinie 1999/44/EG zu vereinbarenden Auslegung sicherzustellen, dass der Verbraucher sein Recht auf Vertragsauflösung ausüben kann.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2019
IBRRS 2019, 4030 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 14.11.2019 - 16 U 42/19
Ein Rücktritt vom Kauf wegen eines Sachmangels ist auch dann, wenn dem Verkäufer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt worden ist, in der Regel erst dann möglich, wenn zwei Nachbesserungsversuche des Verkäufers nicht zur Beseitigung des Mangels geführt haben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 3241
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Brandenburg, Urteil vom 06.08.2019 - 3 U 137/17
1. Für die Frage der Erheblichkeit der Pflichtverletzung ist bei behebbaren Mängeln auf die Kosten der Mängelbeseitigung und nicht auf das Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigung abzustellen.
2. Von einer Geringfügigkeit des Mangels und damit von einer Unerheblichkeit der Pflichtverletzung ist nicht mehr auszugehen, wenn der Mangelbeseitigungsaufwand 5% des Kaufpreises übersteigt.
3. Auf das Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigung kommt es nur an, wenn der Mangel nicht oder nur mit hohen Kosten behebbar oder die Mangelursache im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung ungeklärt ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 3173
 Immobilien
Immobilien
BGH, Urteil vom 14.06.2019 - V ZR 73/18
Die Angabe des fachkundigen Verkäufers, das Kaufobjekt fachgerecht bzw. nach den anerkannten Vorschriften errichtet zu haben, erfolgt nicht schon dann ohne tatsächliche Grundlage "ins Blaue hinein", wenn er bei der Bauausführung unbewusst von einschlägigen DIN-Vorschriften abgewichen ist.*)
IBRRS 2019, 2922
 Baukaufrecht
Baukaufrecht
OLG Köln, Urteil vom 02.09.2016 - 19 U 47/15
Ein Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Transportbeton ist ein Kaufvertrag. Handelt es sich bei den Vertragsparteien um Kaufleute, muss der Käufer (hier: ein Generalunternehmer) den Beton bei Anlieferung untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich rügen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 2883
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 04.06.2019 - 6 O 7787/18
1. Der Käufer kann jedenfalls dann Schadensersatz in Gestalt der voraussichtlichen Mangelbeseitigungskosten verlangen, wenn hinreichend sicher ist, dass er den vorhandenen Zustand nicht akzeptieren wird und er die in sein Anwesen eingebaute mangelhafte Kaufsache entfernen sowie durch eine neu einzubauende Sache ersetzen will. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der eine fiktive Schadensberechnung für die Mangelbeseitigung im Werkvertragsrecht nicht mehr zulässig ist (vgl. BGH, IBR 2018, 196 und IBR 2019, 127), ist insofern nicht übertragbar (entgegen OLG Frankfurt, IBR 2019, 225).*)
2. Sachmängelansprüche wegen eines mangelhaften Parkettklebers, der zu einer Schädigung des zugleich mitverkauften und sodann in einem Gebäude verlegten Parketts geführt hat, unterliegen der fünfjährigen Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 2287
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 02.07.2019 - VIII ZR 74/18
Auch ein Käufer, den die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nach § 377 HGB nicht trifft, kann bei Vorliegen besonderer Umstände gleichwohl eine alsbaldige Untersuchung der Ware und Anzeige etwaiger Mängel vorzunehmen haben (Bestätigung des Senatsurteils vom 06.11.1991 - VIII ZR 294/90, NJW 1992, 912 unter II 1 b).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1890
 Kaufrecht
Kaufrecht
AG Lüneburg, Urteil vom 18.12.2018 - 10 C 157/18
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1528
 Kaufrecht
Kaufrecht
KG, Urteil vom 18.04.2019 - 4 U 42/19
1. Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung vertraglicher (Neben-)Pflichten kann einen vorgelagerten Unterlassungsanspruch begründen, wenn die Verletzungshandlung noch andauert bzw. der daraus resultierende Schaden noch nicht irreparabel ist.
2. Haben die Vertragspartner des Erstkaufvertrags Teilkaufpreise für die einzelnen Gegenstände festgelegt, so ergibt sich aus dieser Festlegung grundsätzlich der vom Vorkaufsberechtigten gem. § 467 Satz 1 BGB zu zahlende Teil des Gesamtpreises.
3. Die Frist gem. § 469 Abs. 2 Satz 1 BGB beginnt beim Grundstückskauf grundsätzlich, wenn der Verkäufer den Vorkaufsberechtigten durch Mitteilung eines wirksamen, vollständigen und richtigen notariellen Kaufvertrages vollständig und zutreffend unterrichtet hat.
4. Verweist die Kaufvertragsurkunde auf eine andere Urkunde, so beginnt die Frist gem. § 469 Abs. 2 Satz 1 BGB nur, wenn auch die andere Urkunde vorgelegt wird, es sei denn, der Berechtigte hat auch ohne diese Urkunde Klarheit über die für seine Entscheidung wesentlichen Punkte.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1472
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Urteil vom 10.04.2019 - VIII ZR 244/16
Zur Frage des Widerrufs einer auf den Abschluss eines an einem Messestand geschlossenen Kaufvertrags gerichteten Willenserklärung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1349
 Baukaufrecht
Baukaufrecht
LG Ravensburg, Urteil vom 06.12.2018 - 2 O 151/14
Eine Schadensberechnung auf Grundlage der fiktiven Mängelbeseitigungskosten ist nach der geänderten Rechtsprechung des BGH (IBR 2018, 196) auch im Kaufrecht nicht mehr zulässig. Die Änderung der Rechtsprechung zu den fiktiven Mängelbeseitigungskosten kann nicht auf das Werkvertragsrecht beschränkt bleiben, weil die Überlegungen im Urteil des BGH vom 22.02.2018 die allgemeinen Grundsätze des Schadensersatzes statt der Leistung betreffen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1449
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 10.04.2019 - VIII ZR 82/17
Zur Frage des Widerrufs einer auf den Abschluss eines an einem Messestand geschlossenen Kaufvertrags gerichteten Willenserklärung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1261
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 20.03.2019 - VIII ZR 88/18
1. Wird eine unter verlängertem Eigentumsvorbehalt verkaufte Photovoltaikanlage vom Eigentumsvorbehaltskäufer weiterveräußert und die hieraus diesem zustehende Kaufpreisforderung (ein zweites Mal) an seine kreditgebende Bank abgetreten, liegt in der Kaufpreiszahlung des Zweiterwerbers bei objektiver Betrachtungsweise aus der Sicht des Zuwendungsempfängers eine Leistung an die Bank, wenn diese die Bewilligung eines für die Durchführung des Kaufvertrags erforderlichen Rangrücktritts mit einem ihr zustehenden Grundpfandrecht von der Zahlung auf ein bankeigenes Konto (CpD) abhängig macht.*)
2. In einem solchen Fall kann sich die Bank nicht darauf berufen, bloße Zahlstelle gewesen zu sein.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 1193
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 20.03.2019 - VIII ZR 213/18
Mit der "nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung" zielt das Gesetz nicht auf konkrete Eigenschaften der Kaufsache ab, die sich der Käufer vorstellt, sondern darauf, ob die Sache für die Nutzungsart (Einsatzzweck) geeignet ist, den die Parteien dem Vertrag zugrunde gelegt haben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0934
 Immobilien
Immobilien
LG Berlin, Urteil vom 06.02.2019 - 21 O 167/18
Die vorhandene Feuchtigkeit des Kellers stellt für sich genommen keinen Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 1 BGB dar. Denn bei älteren Wohnhäusern, die zu einer Zeit errichtet wurden, als Kellerabdichtungen noch nicht üblich waren, stellt nicht schon jede Feuchtigkeit im Keller einen Sachmangel dar.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0646
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 08.01.2019 - VIII ZR 225/17
1. Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn bei Übergabe an den Käufer eine - den Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduzierende - Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 3 Nr. 10 VO 715/2007/EG installiert ist, die gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO 715/2007/EG unzulässig ist.*)
2. Dies hat zur Folge, dass dem Fahrzeug die Eignung für die gewöhnliche Verwendung im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB fehlt, weil die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV) besteht und somit bei Gefahrübergang der weitere (ungestörte) Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr nicht gewährleistet ist.
3. Ob eine gemäß § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB begehrte Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache nach Maßgabe des § 275 Abs. 1 BGB unmöglich ist, hängt nicht von der Unterscheidung zwischen Stück- und Gattungskauf, sondern vom Inhalt und der Reichweite der vom Verkäufer vertraglich übernommenen Beschaffungspflicht ab (Bestätigung von BGH, Urteile vom 07.06.2006 - VIII ZR 209/05, BGHZ 168, 64 Rn. 20 = IBRRS 2006, 2822 = IMRRS 2006, 1944; vom 17.10.2018 - VIII ZR 212/17, NJW 2019, 80 Rn. 20 = IBRRS 2018, 3589 [zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt]).*)
4. Bei der durch interessengerechte Auslegung des Kaufvertrags (§§ 133, 157 BGB) vorzunehmenden Bestimmung des Inhalts und der Reichweite der vom Verkäufer übernommenen Beschaffungspflicht ist zu berücksichtigen, dass die Pflicht zur Ersatzbeschaffung gleichartige und gleichwertige Sachen erfasst. Denn der Anspruch des Käufers auf Ersatzlieferung gemäß § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB richtet sich darauf, dass anstelle der ursprünglich gelieferten mangelhaften Kaufsache nunmehr eine mangelfreie, im Übrigen aber gleichartige und - funktionell sowie vertragsmäßig - gleichwertige Sache zu liefern ist (Bestätigung von BGH, Urteile vom 07.06,.2006 - VIII ZR 209/05, aaO Rn. 23; vom 17.10.2012 - VIII ZR 226/11, BGHZ 195, 135 Rn. 24 = IBR 2013, 176; vom 24.10.2018 - VIII ZR 66/17, NJW 2019, 292 Rn. 41 = IBRRS 2018, 3672 [zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt]). Die Lieferung einer identischen Sache ist nicht erforderlich. Vielmehr ist insoweit darauf abzustellen, ob die Vertragsparteien nach ihrem erkennbaren Willen und dem Vertragszweck die konkrete Leistung als austauschbar angesehen haben (Bestätigung von BGH, Urteil vom 21.11.2017 - X ZR 111/16, NJW 2018, 789 Rn. 8 = IBRRS 2018, 0270).*)
5. Für die Beurteilung der Austauschbarkeit der Leistung ist ein mit einem Modellwechsel einhergehender, mehr oder weniger großer Änderungsumfang des neuen Fahrzeugmodells im Vergleich zum Vorgängermodell nach der Interessenlage des Verkäufers eines Neufahrzeugs in der Regel nicht von Belang. Insoweit kommt es - nicht anders als sei ein Fahrzeug der vom Käufer erworbenen Modellreihe noch lieferbar - im Wesentlichen auf die Höhe der Ersatzbeschaffungskosten an. Diese führen nicht zum Ausschluss der Leistungspflicht nach § 275 Abs. 1 BGB, sondern können den Verkäufer gegebenenfalls unter den im Einzelfall vom Tatrichter festzustellenden Voraussetzungen des § 439 Abs. 4 BGB berechtigen, die Ersatzlieferung zu verweigern, sofern diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0341
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 08.01.2019 - VIII ZR 18/18
Eine vom Verkäufer verwendete Allgemeine Geschäftsbedingung, wonach Mängel der Kaufsache ausschließlich gegenüber der "Betriebsleitung" zu rügen sind, hält einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nicht stand. Sie benachteiligt den Käufer schon deshalb unangemessen, weil sie das Risiko, ob eine an den Verkäufer gerichtete Mängelrüge unternehmensintern die "Betriebsleitung" erreicht, dem Käufer auferlegt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2019, 0011
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Koblenz, Urteil vom 29.11.2018 - 1 U 679/18
1. Im Regelfall muss der Kläger bei einem Nacherfüllungsverlangen (bei Mangel einer Kaufsache) nicht eigeninitiativ und explizit die Möglichkeit der Überprüfung des Mangels anbieten.*)
2. Nicht entschieden ist die Beantwortung der Frage, ob nach der BGH-Entscheidung zum ausgeschlossenen Ersatz fiktiver Mangelbeseitigungskosten im Werkvertragsrecht (BGH, IBR 2018, 196) dieser dort festgelegte Ausschluss auch im Kaufrecht Anwendung unter dem Gesichtspunkt eines Bereicherungsverbots für den Geschädigten findet.*)
3. Bietet der Auto-Hersteller eine kostenfreie, vollständige und zumutbare Mangelbeseitigung an, so kann der Käufer wegen seiner Schadensminderungspflicht im Regelfall nicht Gewährleistungsrechte gegenüber seinem Verkäufer durchsetzen.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2018
IBRRS 2018, 3724 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Koblenz, Beschluss vom 06.11.2018 - 1 U 678/18
1. Ob Mängelbeseitigungsansprüche oder -versuche des Verkäufers nur zu einer Hemmung der Verjährung im Sinne von § 203 BGB oder zum Neubeginn der Verjährung gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB führen, hängt davon ab, ob die betreffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls als konkludentes Anerkenntnis der Mängelbeseitigungspflicht des Verkäufers anzusehen sind. Dies ist keinesfalls regelmäßig anzunehmen, sondern nur dann, wenn der Verkäufer aus der Sicht des Käufers nicht nur aus Kulanz oder zur gütlichen Beilegung eines Streits, sondern in dem Bewusstsein handelt, zur Mängelbeseitigung verpflichtet zu sein. Erheblich sind dabei vor allem der Umfang, die Dauer und die Kosten der Mängelbeseitigung (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 05.10.2005 - VII ZR 16/05; Urteil vom 08.07.1987 - VIII ZR 274/86, IBRRS 2011, 4271; Urteil vom 02.06.1999 - VIII ZR 322/98, IBRRS 2000, 0756; OLG Celle, Urteil vom 20.06.2006 - 16 U 287/05, IBRRS 2006, 2828).*)
2. Ausnahmsweise kann ein Neubeginn des Laufs der Verjährung angenommen werden, wenn es sich um denselben Mangel oder um die Folgen einer mangelhaften Nachbesserung handelt und die betreffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Einzelfalls als konkludentes Anerkenntnis der Mängelbeseitigungspflicht des Verkäufers anzusehen sind (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 05.10.2005 - VII ZR 16/05; Urteil vom 08.07.1987 - VIII ZR 274/86, IBRRS 2011, 4271; Urteil vom 02.06.1999 - VIII ZR 322/98, IBRRS 2000, 0756; OLG Celle, Urteil vom 20.06.2006 - 16 U 287/05, IBRRS 2006, 2828; vgl. auch Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Auflage 2017, Rz. 4150 ff.).*)
3. Wird der Verkäufer eines Wohnwagens im Rahmen eines Garantieauftrags tätig, ist damit nicht konkludent die Erklärung verbunden, auch im Rahmen einer etwaigen Gewährleistungspflicht tätig werden zu wollen oder sich zur Gewährleistung verpflichtet zu sehen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 3723
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Koblenz, Beschluss vom 21.09.2018 - 1 U 678/18
1. Ob Mängelbeseitigungsansprüche oder -versuche des Verkäufers nur zu einer Hemmung der Verjährung im Sinne von § 203 BGB oder zum Neubeginn der Verjährung gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB führen, hängt davon ab, ob die betreffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls als konkludentes Anerkenntnis der Mängelbeseitigungspflicht des Verkäufers anzusehen sind. Dies ist keinesfalls regelmäßig anzunehmen, sondern nur dann, wenn der Verkäufer aus der Sicht des Käufers nicht nur aus Kulanz oder zur gütlichen Beilegung eines Streits, sondern in dem Bewusstsein handelt, zur Mängelbeseitigung verpflichtet zu sein. Erheblich sind dabei vor allem der Umfang, die Dauer und die Kosten der Mängelbeseitigung (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 05.10.2005 - VII ZR 16/05; Urteil vom 08.07.1987 - VIII ZR 274/86 = IBRRS 2011, 4271; Urteil vom 02.06.1999 - VIII ZR 322/98 = IBRRS 2000, 0756; OLG Celle, Urteil vom 20.06.2015 - 16 U 287/05).*)
2. Ausnahmsweise kann ein Neubeginn des Laufs der Verjährung angenommen werden, wenn es sich um denselben Mangel oder um die Folgen einer mangelhaften Nachbesserung handelt und die betreffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Einzelfalls als konkludentes Anerkenntnis der Mängelbeseitigungspflicht des Verkäufers anzusehen sind (in Anknüpfung an BGH, Urteil vom 05.10.2005 - VII ZR 16/05, Urteil vom 08.07.1987 - VIII ZR 274/86 = IBRRS 2011, 4271; Urteil vom 02.06.1999 - VIII ZR 322/98 = IBRRS 2000, 0756; OLG Celle, Urteil vom 20.06.2015 - 16 U 287/05).*)
3. Wird der Verkäufer im Rahmen eines Garantieauftrags tätig, ist damit nicht konkludent die Erklärung verbunden, für etwaig zukünftig eintretende Mängel eines reparierten Wohnwagens zur Gewährleistung verpflichtet zu sehen. Aus dem Tätigwerden des Verkäufers kann nicht ein Anerkenntnis einer Gewährleistungsverpflichtung im Sinne von § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB angenommen werden kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 3672
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 24.10.2018 - VIII ZR 66/17
1. Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn die Software der Kupplungsüberhitzungsanzeige eine Warnmeldung einblendet, die den Fahrer zum Anhalten auffordert, um die Kupplung abkühlen zu lassen, obwohl dies auch bei Fortsetzung der Fahrt möglich ist.*)
2. An der Beurteilung als Sachmangel ändert es nichts, wenn der Verkäufer dem Käufer mitteilt, es sei nicht notwendig, die irreführende Warnmeldung zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer zugleich der Hersteller des Fahrzeugs ist.*)
3. Der Verkäufer eines mit einem Softwarefehler behafteten Neufahrzeugs kann der vom Käufer beanspruchten Ersatzlieferung eines mangelfreien Fahrzeugs nicht entgegenhalten, diese sei unmöglich geworden (§ 275 Abs. 1 BGB), weil die nunmehr produzierten Fahrzeuge der betreffenden Modellversion mit einer korrigierten Version der Software ausgestattet seien.*)
4. Der Wahl der Nacherfüllung durch Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache steht - in den Grenzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) - grundsätzlich nicht entgegen, dass der Käufer zuvor vergeblich Beseitigung des Mangels (§ 439 Abs. 1 Alt. 1 BGB) verlangt hat.*)
5. Das Festhalten des Käufers an dem wirksam ausgeübten Recht auf Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache ist - ebenso wie das Festhalten des Käufers an einem wirksam erklärten Rücktritt vom Kaufvertrag (BGH, IBR 2009, 77; Urteil vom 26.10.2016 - VIII ZR 240/15, IBRRS 2016, 3065 = NJW 2017, 153 Rz. 31) - nicht treuwidrig, wenn der Mangel nachträglich ohne Einverständnis des Käufers beseitigt wird (hier durch Aufspielen einer korrigierten Version der Software).*)
6. Ob die vom Käufer beanspruchte Art der Nacherfüllung (hier: Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache) im Vergleich zu der anderen Variante (hier: Beseitigung des Mangels) wegen der damit verbundenen Aufwendungen für den Verkäufer unverhältnismäßige Kosten verursacht und diesen deshalb unangemessen belastet, entzieht sich einer verallgemeinerungsfähigen Betrachtung und ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung und Würdigung aller maßgeblichen Umstände des konkreten Einzelfalls unter Berücksichtigung der in § 439 Abs. 3 Satz 2 BGB a.F. (§ 439 Abs. 4 Satz 2 BGB) genannten Kriterien festzustellen.*)
7. Für die Beurteilung der relativen Unverhältnismäßigkeit der vom Käufer gewählten Art der Nacherfüllung im Vergleich zu der anderen Art ist grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Zugangs des Nacherfüllungsverlangens abzustellen.*)
8. Der auf Ersatzlieferung in Anspruch genommene Verkäufer darf den Käufer nicht unter Ausübung der Einrede der Unverhältnismäßigkeit auf Nachbesserung verweisen, wenn der Verkäufer den Mangel nicht vollständig, nachhaltig und fachgerecht beseitigen kann.*)
9. § 439 Abs. 2 BGB kann verschuldensunabhängig auch vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten erfassen, die dem Käufer entstehen, um das Vertragsziel der Lieferung einer mangelfreien Sache zu erreichen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 2667
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Bamberg, Beschluss vom 16.05.2018 - 3 U 54/18
Der Käufer einer Sache genügt seiner Beweislast für das Fehlschlagen der Nachbesserung auch dann, wenn das Mangelsymptom auch nach dem dritten Nachbesserungsversuch noch auftritt und der Verkäufer nunmehr die Vermutung äußert, dass der Mangel mit einem nach Übergabe entstandenen Defekt an einem anderen Bauteil zusammenhängt (Fortführung von BGH, IBR 2011, 257).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 2652
 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Arnsberg, Urteil vom 28.05.2018 - 2 O 349/15
1. Ein Rücktritt wegen Mängeln ist ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung des Verkäufers/Unternehmers nur unerheblich ist.
2. Die Beurteilung der Frage, ob eine Pflichtverletzung unerheblich ist, erfordert eine umfassende Interessenabwägung auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls.
3. Von einer Geringfügigkeit eines behebbaren Mangels und damit von einer Unerheblichkeit der Pflichtverletzung ist auszugehen, wenn die Kosten der Mangelbeseitigung im Verhältnis zum Kaufpreis/Werklohn geringfügig sind. Nicht mehr geringfügig sind Mangelbeseitigungskosten in Höhe von 5% des Kaufpreises/Werklohns.
4. Auch im Werkvertragsrecht gilt die Mängelbeseitigung nach dem zweiten erfolglosen Versuch der Nacherfüllung in der Regel als fehlgeschlagen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 2073
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 26.01.2018 - 13 U 214/15
1. Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Dabei ist ein sog. wucherähnliches Geschäft anzunehmen, wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung und eine verwerfliche Gesinnung des Begünstigten als weiteres, subjektives Element festgestellt werden kann.
2. Ein besonders grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung liegt vor, wenn der Wert der Leistung rund doppelt so hoch ist wie der Wert der Gegenleistung.
3. Ist das Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besonders grob, kann allein dies den Schluss auf die bewusste oder grob fahrlässige Ausnutzung eines den Vertragspartner in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Umstands rechtfertigen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 1850
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 09.05.2018 - VIII ZR 26/17
1. Die mangelbedingte Minderung des Kaufpreises ist vom Gesetzgeber als Gestaltungsrecht ausgeformt worden. Mit dem Zugang einer wirksam ausgeübten Minderung des Kaufpreises wird diese Erklärung bindend; der Käufer ist damit daran gehindert, hiervon wieder Abstand zu nehmen und stattdessen wegen desselben Mangels auf großen Schadensersatz überzugehen und unter diesem Gesichtspunkt Rückgängigmachung des Kaufvertrags zu verlangen.*)
2. Nach der Konzeption des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts ist ein Käufer ferner daran gehindert, unter Festhalten an der von ihm nicht mehr zu beseitigenden Gestaltungswirkung der Minderung zusätzlich (nebeneinander) großen Schadensersatz geltend zu machen und auf diesem Wege im Ergebnis nicht nur eine Herabsetzung des Kaufpreises zu erreichen, sondern den - gegebenenfalls um Gegenforderungen reduzierten - Kaufpreis insgesamt zurückzufordern. Denn der Käufer hat mit der wirksamen Ausübung der Minderung zugleich das ihm vom Gesetzgeber eingeräumte Wahlrecht zwischen Festhalten am und Lösen vom Kaufvertrag "verbraucht".*)
3. Aus der Vorschrift des § 325 BGB lässt sich nicht - auch nicht im Wege einer analogen Anwendung - eine Berechtigung des Käufers ableiten, von einer wirksam erklärten Minderung zu einem Anspruch auf großen Schadensersatz und damit auf Rückabwicklung des Kaufvertrags zu wechseln.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2018, 0155
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 06.12.2017 - VIII ZR 245/16
1. Gemäß § 377 Abs. 1 HGB hat eine Untersuchung der gelieferten Ware zu erfolgen, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Welche Anforderungen an die Art und Weise der Untersuchung zu stellen sind, lässt sich nicht allgemein festlegen.
2. Die von § 377 Abs. 1 HGB geforderte Untersuchung muss nicht von derartigem Umfang und solcher Intensität sein, dass sie nach Art einer "Rundum-Untersuchung" alle irgendwie in Betracht kommenden Mängel der Ware erfasst.
IBRRS 2018, 0110
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Heidelberg, Urteil vom 20.12.2017 - 1 S 28/17
Eine nach Mängelmitteilung getroffene Vereinbarung im Verbrauchsgüterkauf, mit der dem Käufer (hier: eines PKW) eine Kostentragung bei der Nacherfüllung auferlegt wird, ist unwirksam, wenn diesem nicht bewusst ist, dass dabei zu seinem Nachteil von seinen Gewährleistungsrechten abgewichen wird.
 Volltext
Volltext