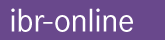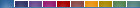Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
160 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2018
IBRRS 2018, 0109 Prozessuales
Prozessuales
LG Kiel, Urteil vom 21.12.2017 - 12 O 537/17
Der nicht begründete Widerspruch gegen einen Mahnbescheid kann nicht als ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung angesehen werden.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2017
IBRRS 2017, 4239 Notare
Notare
LG Halle, Beschluss vom 05.09.2017 - 4 OH 21/16
1. Ein Kaufvertragsentwurf, der noch nicht die zahlreichen Änderungswünsche des Käufers berücksichtigt und noch erhebliche rechtliche Problemstellungen beinhaltet, ist unvollständig.
2. Die Unvollständigkeit des Kaufvertragsentwurfs führt jedoch nicht dazu, dass die Käufer geringere Notarkosten zu zahlen haben, denn für die Wertbestimmung kommt es allein auf den Kaufpreis an.
3. Die Bewertungsvorschrift des § 47 GNotKG ist für alle mit einem Kaufvertrag in Zusammenhang stehenden Geschäfte anzuwenden und geht als speziellere Vorschrift - nur für Kaufverträge - der allgemeinen Regelung des § 96 GNotKG vor.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 4246
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 18.10.2017 - VIII ZR 86/16
1. Die in einer Qualitätssicherungsvereinbarung zwischen Unternehmern vom Käufer formularmäßig verwendete Klausel "Mehraufwand bei dem AG, der aus Mängeln von Liefergegenständen entsteht, geht in angefallener Höhe zu Lasten des AN. Der Mehraufwand ist dem AN durch den AG nachzuweisen." hält einer Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht stand, weil sie ohne sachlichen Grund von den Regelungen des gesetzlichen Kaufgewährleistungsrechts in einer Weise abweicht, die mit wesentlichen Grundgedanken dieser gesetzlichen Regelungen nicht zu vereinbaren ist.*)
2. Soweit der danach ersatzpflichtig gestellte Mehraufwand jedenfalls bei kundenfeindlichster Auslegung allein an eine mangelbedingte Verursachung anknüpft, erfasst die Klausel in weitgehendem Umfang auch Aufwandspositionen, die - wenn überhaupt - nach der gesetzlichen Gewährleistungskonzeption nur von einer verschuldensabhängigen Schadens- oder Aufwendungsersatzhaftung gedeckt wären, und verschiebt dadurch eine Gewährleistungshaftung grundlegend zu Lasten des Verkäufers.*)
3. Soweit eine Erstattungspflicht darin ferner nicht auf Aufwendungen beschränkt ist, deren Anfall unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen nach objektiven Maßstäben billigerweise notwendig und angemessen war, wird ein etwa in §§ 284, 439 Abs. 2 BGB als Ausdruck eines grundlegenden Gebotes der Gerechtigkeit angelegtes Erfordernis missachtet, wonach ein Käufer im Falle einer mangelhaften Lieferung nicht mit jedem nach dem Belieben oder den subjektiven Zweckmäßigkeitserwägungen des Käufers verursachten oder zur Beseitigung oder Milderung der Mangelfolgen veranlassten (Mehr-)Aufwand belastet werden darf.*)
4. Zudem schneidet die Klausel jedenfalls bei kundenfeindlichster Auslegung dem Verkäufer hinsichtlich Entstehung und Höhe des Mehraufwands auch einen Mitverschuldens- oder Mitverursachungseinwand ab.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 4438
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 06.12.2017 - VIII ZR 246/16
1. Für die Untersuchungsobliegenheit nach § 377 Abs. 1 HGB ist darauf abzustellen, welche in den Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs fallenden Maßnahmen einem ordentlichen Kaufmann im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung auch der schutzwürdigen Interessen des Verkäufers zur Erhaltung seiner Gewährleistungsrechte zugemutet werden können. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Vorschriften über die Mängelrüge in erster Linie den Interessen des Verkäufers dienen, der nach Möglichkeit davor geschützt werden soll, sich längere Zeit nach der Lieferung oder nach der Abnahme der Sache etwaigen, dann nur schwer feststellbaren oder durch die Untersuchung vermeidbaren Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt zu sehen. Andererseits dürfen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Untersuchung nicht überspannt werden, weil ansonsten der Verkäufer, aus dessen Einflussbereich der Mangel kommt, in die Lage versetzt werden könnte, das aus seinen eigenen fehlerhaften Leistungen herrührende Risiko über das Erfordernis der Mängelrüge auf den Käufer abzuwälzen. Anhaltspunkte für die Grenzen der Zumutbarkeit bilden vor allem der für eine Überprüfung erforderliche Kosten- und Zeitaufwand, die dem Käufer zur Verfügung stehenden technischen Prüfungsmöglichkeiten, das Erfordernis eigener technischer Kenntnisse für die Durchführung der Untersuchung beziehungsweise die Notwendigkeit, die Prüfung von Dritten vornehmen zu lassen (Bestätigung des Senatsurteils vom 24.02.2016 - VIII ZR 38/15, IBR 2016, 312).*)
2. Die von § 377 Abs. 1 HGB geforderte Untersuchung muss nicht von derartigem Umfang und solcher Intensität sein, dass sie nach Art einer "Rundum-Untersuchung" alle irgendwie in Betracht kommenden Mängel der Ware erfasst.*)
3. Für die schlüssige Darstellung eines Handelsbrauchs genügt nicht die bloße Behauptung, in einem bestimmten Geschäftsbereich werde üblicherweise etwas in einer bestimmten Weise gehandhabt. Unerlässlich ist vielmehr der Vortrag konkreter Anknüpfungstatsachen, die den Schluss auf eine in räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht ausreichende einheitliche, auf Konsens der beteiligten Kreise hindeutende Verkehrsübung in Bezug auf einen bestimmten Vorgang zulassen.*)
4. Art und Umfang einer gebotenen Untersuchung können durch AGB zwar in bestimmter Weise, etwa hinsichtlich der zu untersuchenden Eigenschaften und der dabei vorzugsweise anzuwendenden Methoden, konkretisiert und gegebenenfalls auch generalisiert werden, sofern dies durch die Umstände veranlasst oder durch eine in dieser Richtung verlaufende Verkehrsübung vorgezeichnet ist und die Konkretisierung oder Generalisierung eine hinreichende Rücksichtnahme auf die beiderseitigen Interessen erkennen lässt. Unangemessen benachteiligend ist es aber, wenn die Klausel ohne nähere Differenzierung nach Anlass und Zumutbarkeit stets eine vollständige Untersuchung der Ware auf ein Vorhandensein aller nicht sofort feststellbarer Mängel fordert und keinen Raum für Abweichungen lässt, in denen eine Untersuchung vernünftigerweise unangemessen ist oder dem Käufer sonst billigerweise nicht mehr zugemutet werden kann.*)
5. Mit dem Zweck der Untersuchungsobliegenheit, eine im Falle der Mangelhaftigkeit erforderliche Mängelrüge vorzubereiten, also etwaige Mängel zu erkennen und über die dabei gewonnenen Erkenntnisse eine danach gebotene Mängelrüge hinreichend konkret zu formulieren, ist es nicht zu vereinbaren, dem Käufer in AGB die Untersuchung der Ware durch einen neutralen Sachverständigen vorzuschreiben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3887
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 18.10.2017 - VIII ZR 32/16
1. Auch bei einem hochpreisigen Dressurpferd begründet das Vorhandensein eines "Röntgenbefundes", sofern die Kaufvertragsparteien keine anderslautende Beschaffenheitsvereinbarung geschlossen haben, für sich genommen grundsätzlich noch keinen Sachmangel nach § 434 Abs. 1 Satz 2 BGB (Bestätigung und Fortführung von BGH, 07.02.2007 - VIII ZR 266/06, IBRRS 2007, 2946; IMRRS 2007, 1156; BGH, 29.03.2006 - VIII ZR 173/05, IBRRS 2006, 1821; IMRRS 2006, 1131). Hierbei kommt es nicht entscheidend darauf an, wie häufig derartige Röntgenbefunde vorkommen (insoweit Klarstellung von BGH, 07.02.2007 - VIII ZR 266/06, IBRRS 2007, 2946; IMRRS 2007, 1156, aaO Rn. 20).*)
2. Der Verkäufer eines solchen Dressurpferdes hat - wie auch sonst beim Verkauf eines Reitpferdes - ohne eine anderslautende Beschaffenheitsvereinbarung der Kaufvertragsparteien nur dafür einzustehen, dass das Tier bei Gefahrübergang nicht krank ist und sich auch nicht in einem (ebenfalls vertragswidrigen) Zustand befindet, aufgrund dessen bereits die Sicherheit oder zumindest hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es alsbald erkranken wird und es deshalb oder aus sonstigen Gründen für die vertraglich vorausgesetzte beziehungsweise gewöhnliche Verwendung nicht mehr einsetzbar sein wird (Bestätigung und Fortführung BGH, 29.03.2006 - VIII ZR 173/05, IBRRS 2006, 1821; IMRRS 2006, 1131 aaO Rn. 37; BGH, 07.02.2007 - VIII ZR 266/06, IBRRS 2007, 2946; IMRRS 2007, 1156 aaO).*)
3. Die Veräußerung eines vom Verkäufer - hier einem nicht im Bereich des Pferdehandels tätigen selbständigen Reitlehrer und Pferdeausbilder - ausschließlich zu privaten Zwecken genutzten Pferdes ist regelmäßig nicht als Unternehmergeschäft zu qualifizieren (im Anschluss an BGH, 13.03.2013 - VIII ZR 186/12, IBRRS 2013, 1507; BGH, 27.09.2017 - VIII ZR 271/16, IBRRS 2017, 3568, unter II 3 b, zur Veröffentlichung vorgesehen).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3568
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 27.09.2017 - VIII ZR 271/16
1. Der Verkäufer kann im Hinblick auf die in § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB getroffene gesetzgeberische Wertung grundsätzlich seine Haftung nicht nur für das Fehlen einer üblichen und vom Käufer zu erwartenden Beschaffenheit (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB), sondern auch für das Fehlen von Eigenschaften ausschließen, deren Vorhandensein der Käufer nach den vom Verkäufer abgegebenen öffentlichen Äußerungen berechtigterweise erwarten kann (im Anschluss an BGH, Urteil vom 22.04.2016 - V ZR 23/15, IMR 2016, 478 = NJW 2017, 150 Rz. 14).*)
2. Für die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Unternehmerhandeln ist grundsätzlich die objektiv zu bestimmende Zweckrichtung des Rechtsgeschäfts entscheidend (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 24.02.2005 - III ZB 36/04, BGHZ 162, 253, 256 f. = IBR 2006, 1156 - nur online; Urteil vom 15.11.2007 - III ZR 295/06, NJW 2008, 435 Rz. 6 f. = IBR 2008, 1016 - nur online; EuGH, Urteile vom 09.11.2016 - Rs. C-149/15, NJW 2017, 874 Rz. 32, und vom 03.09.2015 - Rs. C-110/14, ZIP 2015, 1882 Rz. 16 ff., insb. Rz. 21). Dabei kommt es maßgeblich auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles, insbesondere das Verhalten der Parteien bei Vertragsschluss an. In bestimmten Fällen kann es allerdings auch ausreichen, dass dem Käufer vor oder bei Vertragsschluss der Eindruck vermittelt wird, er erwerbe die Kaufsache von einem Unternehmer (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 09.11.2016 - Rs. C-149/15, a.a.O. Rz. 34 - 45).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3488
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Urteil vom 27.09.2017 - VIII ZR 99/16
Zwei Ansprüche beruhen auf "demselben Grund" im Sinne von § 213 BGB, wenn sie aus demselben, durch das Anspruchsziel geprägten Lebenssachverhalt abgeleitet sind, der die Grundlage für das Entstehen der beiden Ansprüche darstellt; der Anspruchsgrund muss "im Kern" identisch sein. Hieran fehlt es im Verhältnis zwischen kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüchen einerseits und Ansprüchen aus einer daneben abgeschlossenen (Haltbarkeits-)Garantie andererseits (Fortführung Senatsurteil vom 29.04.2015 - VIII ZR 180/14, BGHZ 205, 151 = IBRRS 2015, 1806 = IMRRS 2015, 1522).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3486
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Naumburg, Urteil vom 19.05.2017 - 7 U 3/17
1. Für den Erfüllungsort der Nacherfüllung gilt die allgemeine Vorschrift des § 269 Abs. 1 BGB.*)
2. Danach sind in erster Linie die von den Parteien getroffenen Vereinbarungen entscheidend. Fehlen vertragliche Abreden über den Erfüllungsort, ist auf die jeweiligen Umstände, insbesondere die Natur des Schuldverhältnisses, abzustellen. Lassen sich auch hieraus keine abschließenden Erkenntnisse gewinnen, ist der Erfüllungsort letztlich an dem Ort anzusiedeln, an welchem der Verkäufer zum Zeitpunkt der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hatte, wenn nicht erhebliche Unannehmlichkeiten für den Käufer entstehen. Die bloße Verbringung des Kaufgegenstandes an den Sitz des Schuldners zum Zwecke der Nachbesserung stellt keine erhebliche Unannehmlichkeit für den Käufer dar.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 3050
 Kaufrecht
Kaufrecht
VG Greifswald, Urteil vom 24.08.2017 - 3 A 843/14
1. Der gegen die Erhebung eines Anschlussbeitrags i.S.d. § 9 KAG M-V geltend gemachte Einwand, im Rahmen eines mit dem Gläubiger des Beitragsanspruchs geschlossenen Grundstückskaufvertrages habe dieser auf die Erhebung von Anschlussbeiträgen verzichtet, ist im Anfechtungsprozess zu prüfen.*)
2. Es kommt insoweit nicht darauf an, ob die Vereinbarung den Schwerpunkt des Kaufvertrages bildet. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Vereinbarung den Schwerpunkt der Rechtsstreitigkeit bildet.*)
3. Im Rahmen der Prüfung des Verwaltungsrechtsweges ist der Vortrag des Klägers maßgeblich. Ob der Vortrag zutrifft, ist Gegenstand der Sachprüfung.*)
4. Eine vor der Geltung des KAG 1991 zwischen dem Gläubiger des (künftigen) Beitragsanspruchs und dem Beitragspflichtigen vereinbarte Freistellung von Erschließungskosten verstößt nicht gegen ein gesetzliches Verbot i.S.d. § 134 BGB.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2706
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Hamburg, Urteil vom 04.07.2017 - 326 O 193/15
1. Trotz wirksam vereinbarten Gewährleistungsausschlusses für Rechts- und Sachmängel und ohne dass dem Verkäufer Arglist nachgewiesen werden muss, kann die Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten einen Schadensersatzanspruch auslösen.
2. Eine zum Schadensersatz verpflichtende Aufklärungspflichtverletzung kann darin begründet sein, dass der Verkäufer einer Eigentumswohnung auch ohne Nachfrage des Erwerbers nicht darüber aufklärt, dass auf dem Nachbargrundstück eine Bebauung geplant wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2897
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 19.07.2017 - VIII ZR 278/16
1. Ein taugliches Nacherfüllungsverlangen des Käufers setzt die Zurverfügungstellung der Kaufsache am rechten Ort, nämlich dem Erfüllungsort der Nacherfüllung, voraus. Für dessen Bestimmung ist im Kaufrecht die allgemeine Vorschrift des § 269 Abs. 1, 2 BGB maßgebend (Bestätigung der Senatsrechtsprechung, vgl. Senatsurteile vom 13.04.2011 - VIII ZR 220/10, BGHZ 189, 196 Rn. 29 ff. mwN = IBR 2011, 731; vom 19.12.2012 - VIII ZR 96/12, NJW 2013, 1074 Rn. 24 = IBR 2013, 178).*)
2. Die Kostentragungsregelung des § 439 Abs. 2 BGB begründet in Fällen, in denen eine Nacherfüllung die Verbringung der Kaufsache an einen entfernt liegenden Nacherfüllungsort erfordert und bei dem Käufer deshalb Transportkosten zwecks Überführung an diesen Ort anfallen, bei einem Verbrauchsgüterkauf nicht nur einen Erstattungsanspruch gegen den Verkäufer; der Käufer kann nach dem Schutzzweck der von Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie geforderten Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung vielmehr grundsätzlich schon vorab einen (abrechenbaren) Vorschuss zur Abdeckung dieser Kosten beanspruchen, auch wenn das Vorliegen des geltend gemachten Mangels noch ungeklärt ist. Dementsprechend liegt ein taugliches Nacherfüllungsverlangen des Käufers vor, wenn seine Bereitschaft, die Kaufsache zum Ort der Nacherfüllung zu verbringen, nur wegen der ausgebliebenen Vorschussleistung des Verkäufers nicht umgesetzt wird (Fortführung des Senatsurteils vom 13.04.2011 - VIII ZR 220/10, aaO Rn. 37 = IBRRS 2011, 2024).*)
IBRRS 2017, 2722
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG München, Urteil vom 20.07.2017 - 23 U 951/17
1. Durch die Annahme von gelieferten Materialien kann ein Kaufvertrag (konkludent) zustande kommen.
2. Ein nicht unterschriebener Lieferschein beweist allenfalls, dass die aufgeführten Materialien einer Spedition übergeben wurden, jedoch nicht, dass der Käufer die Materialien auch erhalten hat.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2433
 Immobilien
Immobilien
OLG Saarbrücken, Urteil vom 22.06.2017 - 4 U 30/16
1. Übergibt der Verkäufer ein Gutachten über die Ursachen einer Schimmelbildung aus Beweissicherungsgründen, so will er hiermit regelmäßig nur seiner Offenbarungspflicht genügen und nicht die Gewähr für die Richtigkeit des Gutachtens übernehmen.
2. Vereinbaren die Parteien als Soll-Beschaffenheit des gesamten Kaufgegenstands zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs dessen Nutzung als Vermietungsobjekt zu Wohnzwecken, so geht damit die Zusage einher, dass der Kaufgegenstand einen baulichen Zustand aufweist, der diese Nutzung zulässt.
3. Sind in einem Kaufvertrag zugleich eine bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache und ein pauschaler Ausschluss der Sachmängelhaftung vereinbart, kann dieser in der Regel nur dahin ausgelegt werden, dass der Haftungsausschluss nicht für das Fehlen der vereinbarten Beschaffenheit nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB gelten soll. Dies gilt auch, wenn eine bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache nicht ausdrücklich, sondern "nur" konkludent vereinbart worden ist.
4. Das Recht des Käufers, wegen eines Sachmangels Minderung zu verlangen, setzt nach § 437 Nr. 2 i.V.m. § 441 Abs. 1, § 323 Abs. 1 Satz 1 BGB grundsätzlich voraus, dass der Käufer dem Verkäufer unter Setzung einer angemessenen Nachfrist erfolglos Gelegenheit zur Nacherfüllung nach § 439 BGB gegeben hat. Nach § 440 Satz 1 Alt. 3 BGB ist eine Nacherfüllungsaufforderung jedoch entbehrlich, wenn dem Käufer die ihm zustehende Art der Nacherfüllung unzumutbar ist. Die Unzumutbarkeit ist anders als bei den in §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB geregelten Tatbeständen aus der Sicht des Käufers zu beurteilen.
5. Es kann einem Käufer im Allgemeinen nicht als Sorgfaltsverstoß angelastet werden, wenn er sich auf die Angaben des Verkäufers zum Kaufgegenstand verlässt und deshalb keine eigenen Nachforschungen anstellt. Eine Obliegenheit des Käufers, den Kaufgegenstand vor dem Abschluss des Kaufvertrags auf etwaige Mängel zu untersuchen, um sich seine Gewährleistungsrechte zu erhalten, wird durch § 442 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht begründet.
6. Bei § 439 Abs. 2 BGB handelt es sich um eine Kostentragungsregelung mit Anspruchscharakter, die die Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung für den Käufer gewährleisten soll.
7. Zu den erstattungsfähigen Aufwendungen aus § 439 Abs. 2 BGB gehören auch die Kosten für Gutachten von Sachverständigen, soweit diese zur Klärung der Mangelursache erforderlich sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2646
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 02.05.2017 - 8 U 170/16
1. Offeriert der Verkäufer in einer Anzeige seinen Pkw zum Preis von 11.500 Euro an und lässt er Peisvorschläge zu, kommt kein Kaufvertrag zustande, wenn der Käufer 15 Euro anbietet und der Verkäufer sich hiermit einverstanden erklärt.
2. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Ersatz eines etwaigen Vertrauensschadens, wenn er den Grund der Nichtigkeit des Vertrags kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 2414
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 16.05.2017 - VIII ZR 102/16
1. Vergleichsmaßstab zur Beurteilung der Mangelfreiheit eines Kaufgegenstands ist die Beschaffenheit, die "bei Sachen der gleichen Art" üblich ist und die der Käufer "nach der Art der Sache" erwarten kann.
2. Dementsprechend erstreckt sich bei Kraftfahrzeugen ein am Stand der Technik orientierter Vergleich auf alle Fahrzeuge mit einer nach Bauart und Typ vergleichbaren technischen Ausstattung. Eine hersteller- oder sogar fahrzeugtypspezifische Eingrenzung ist darüber hinaus nicht vorzunehmen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 1906
 Immobilien
Immobilien
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.02.2017 - 24 U 103/16
Wird in einem notariellen Grundstückskaufvertrag bestimmt, dass mit der Kaufpreiszahlung sämtliche Rechte und Pflichten an dem Grundstück auf die neue Eigentümerin übergehen, wird dadurch der Mietanspruch des Veräußerers aus einem Mietvertrag über die Kaufsache für die Zeit nach der Kaufpreiszahlung an den Erwerber mit der Folge abgetreten, dass dieser die Miete auch schon vor Vollendung seines Eigentumserwerbs beanspruchen kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 1886
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 26.04.2017 - VIII ZR 233/15
1. Haben die Vertragsparteien in einem Kaufvertrag über ein gebrauchtes Kraftfahrzeug neben einem Gewährleistungsausschluss zusätzlich ausdrücklich die Rechtsmängelfreiheit der Kaufsache zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht, gilt der Haftungsausschluss nicht für Rechtsmängel gemäß § 435 BGB, sondern ausschließlich für Sachmängel gemäß § 434 BGB (Fortführung von BGH, Urteile vom 29.11.2006 - VIII ZR 92/06, BGHZ 170, 86 Rn. 30 = IBRRS 2007, 3060 = IMRRS 2007, 1225; vom 19.12.2012 - VIII ZR 117/12, NJW 2013, 1733, Rn. 15 = IBRRS 2013, 0305 = IMRRS 2013, 0227; vom 13.03.2013 - VIII ZR 172/12, NJW 2013, 2749 Rn. 19 = IBRRS 2013, 1818; vom 06.11.2015 - V ZR 78/14, BGHZ 207, 349 Rn. 9 = IBRRS 2016, 0244 = IMR 2014, 120; vom 22.04.2016 - V ZR 23/15, NJW 2017, 150 Rn. 14 = IBRRS 2016, 2334 = IMR 2016, 478).*)
2. Die bei Gefahrübergang vorhandene und im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung fortbestehende Eintragung eines Kraftfahrzeugs in dem Schengener Informationssystem (SIS) zum Zwecke der Sicherstellung und Identitätsfeststellung ist ein erheblicher Rechtsmangel, der den Käufer zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt (Bestätigung des Senatsurteils vom 18.01.2017 - VIII ZR 234/15 Rn. 22 ff., IBRRS 2017, 0453).*)
3. Der Verkäufer eines Kraftfahrzeugs ist redlicherweise gehalten, einen potentiellen Käufer über das Bestehen einer Eintragung des Fahrzeugs in dem Schengener Informationssystem aufzuklären (Bestätigung des Senatsurteils vom 18.01.2017 - VIII ZR 234/15 Rn. 27, IBRRS 2017, 0453).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 1876
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 26.04.2017 - VIII ZR 80/16
1. Vertraglich vorausgesetzt im Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 BGB ist die zwar nicht vereinbarte, aber von beiden Vertragsparteien unterstellte Verwendung der Kaufsache, die von der gewöhnlichen Verwendung abweichen kann (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16.03.2012 - V ZR 18/11, NJW-RR 2012, 1078 = IBRRS 2012, 1564 = IMRRS 2012, 1137).*)
2. Die Eignung einer Sache für eine bestimmte Verwendung ist nicht erst zu verneinen, wenn die Tauglichkeit der Kaufsache zu diesem Gebrauch ganz aufgehoben ist, sondern bereits dann, wenn sie lediglich gemindert ist (st. Rspr; zuletzt BGH, Urteil vom 26.10.2016 - VIII ZR 240/15, NJW 2017, 153 Rn. 15 = IBRRS 2016, 3065). So ist die Eignung der Kaufsache für deren nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung grundsätzlich in den Fällen gemindert oder ganz aufgehoben, wenn mit dieser Verwendung erhebliche Gesundheitsgefahren oder das Risiko eines großen wirtschaftlichen Schadens verbunden sind.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 1317
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Nürnberg, Urteil vom 22.02.2017 - 12 U 812/15
1. Eine unzureichende oder fehlende Verpackung begründet nur dann die Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstands, wenn von der Verpackung die Haltbarkeit der Ware, deren Wert oder die Weiterverkaufsmöglichkeit abhängt oder wenn die Originalverpackung die Ware kennzeichnet (im Anschluss an BGH, Urteil vom 28.04.1976 - VIII ZR 244/74, BGHZ 66, 208).*)
2. Zur Frage, ob eine kaufvertragliche Nebenpflicht des Verkäufers zur "sachgemäßen" Verladung und in deren Rahmen auch zur notwendigen Befestigung der Ware - Ladungssicherung - auf dem Fahrzeug des Käufers (oder dessen Frachtführers) besteht (im Anschluss an BGH, Urteil vom 18.06.1968 - VI ZR 120/67, NJW 1968, 1929; Urteil vom 23.03.1977 - IV ZR 35/76, DB 1977, 1500).*)
3. Bei Vereinbarung der Incoterms 2010 FCA ist eine etwaige kaufvertragliche Nebenpflicht des Verkäufers zur Ladungssicherung auf dem Fahrzeug des Käufers (oder dessen Frachtführers) abbedungen.*)
IBRRS 2017, 1100
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
LG Hamburg, Urteil vom 27.09.2016 - 307 O 347/14
1. Vereinbaren Nachbarn, dass über einen installierten Baustromkasten mit Zwischenstromzähler Energie zur Verfügung gestellt wird, wurde ein Kaufvertrag geschlossen.
2. Der bezogene Baustrom ist zu den Konditionen zu vergüten, die dem liefernden Nachbarn in Rechnung gestellt werden.
3. Kann der genaue Stromverbrauch wegen eines Defekts des Baustromzählers nicht rekonstruiert werden, kann der Stromverbrauch geschätzt werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 1009
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Nürnberg, Urteil vom 20.02.2017 - 14 U 199/16
1. Ist die gekaufte Sache im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft und verlangt der Käufer nach seiner Wahl gemäß § 439 Abs. 1 BGB die Lieferung einer mangelfreien Sache, entfällt sein Anspruch nicht aufgrund einer vom Verkäufer anschließend bewirkten Beseitigung des Mangels.*)
2. Dem trotz Mangelbeseitigung am Anspruch auf Nachlieferung festhaltenden Käufer kann der Einwand treuwidrigen Verhaltens (§ 242 BGB) dann nicht entgegengehalten werden, wenn die Mangelbeseitigung ohne seine Zustimmung erfolgt ist.*)
3. Die für einen erstmals im Prozess geltend gemachten Ausschluss der verlangten Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB relevante Bedeutung des Mangels bestimmt sich nach den zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegenden Umständen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0865
 Immobilien
Immobilien
OLG Hamm, Beschluss vom 13.02.2017 - 22 U 104/16
1. Der akute Befall eines zu Wohnzwecken dienenden Gebäudes mit einem oder mehreren Mardern stellt einen Sachmangel im Sinne des §§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB dar, über den der Verkäufer eines Hausgrundstücks oder Eigentumswohnung den Kaufinteressenten aufzuklären hat.*)
2. Dagegen wird ein Sachmangel nicht (auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt eines Mangelverdachts) allein dadurch begründet, dass in der weiter zurückliegenden Vergangenheit ein Marderbefall des Gebäudes zu verzeichnen war. Infolgedessen muss der Verkäufer den Kaufinteressenten über derartige Vorfälle nicht aufklären.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0814
 Kaufrecht
Kaufrecht
AG Dortmund, Urteil vom 21.02.2017 - 425 C 9322/16
1. Ein günstiges Angebot in einem Internetshop (Hier: elektrische Vollkassettenmarkisen) nutzen zu wollen, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden und auch nicht treuwidrig.
2. Muss für den Käufer aber offensichtlich sein, dass es sich bei der Preisgestaltung nur um einen Fehler handeln kann, weil der Preis im Vergleich zur Herstellerpreisempfehlung 98% günstiger ist, handelt der Käufer treuwidrig, wenn er dies auch noch durch Bestellung mehrerer Exemplare für Freunde ausnutzt.
3. Da ein Festhalten am Vertrag unbillig und rechtsmissbräuchlich wäre, ist der Händler nach Treu und Glaube nicht zur Lieferung der Ware verpflichtet.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0462
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Beschluss vom 14.12.2016 - V ZR 254/15
Der Kaufpreis ist nach Maßgabe der Vorschriften über den Rücktritt zurückzuzahlen, wenn der Verkäufer die Kaufsache nicht mehr zu liefern und zu übereignen braucht und der Käufer dafür nicht verantwortlich ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0260
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG München, Urteil vom 19.12.2016 - 21 U 979/16
1. Macht der Käufer Mängel am Kaufobjekt geltend, muss er die Fehler bzw. Störungen soweit konkretisieren, dass der Verkäufer nachvollziehen kann, inwieweit eine Abweichung von der vertraglich geschuldeten Leistung geltend gemacht wird.
2. Die pauschale Behauptung, die Kaufsache entspreche nicht den vertraglichen Vereinbarungen, ist nicht ausreichend.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2017, 0083
 Immobilien
Immobilien
LG Köln, Urteil vom 22.11.2016 - 5 O 219/16
Hat der Verkäufer einer Immobilie keine Anhaltspunkte dafür, dass die bisherige, langjährige Nutzung nicht genehmigt ist, muss er den Käufer nicht aktiv darauf hinweisen, dass ihm keine schriftliche Baugenehmigung vorliegt.
 Volltext
Volltext
Online seit 2016
IBRRS 2016, 3231 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 26.10.2016 - VIII ZR 211/15
Im Hinblick auf die Verpflichtung des Verkäufers zur Verschaffung einer von Sach- und Rechtsmängeln freien Sache (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB) ist der Käufer bei behebbaren Mängeln, auch wenn sie geringfügig sind, grundsätzlich berechtigt, gemäß § 320 Abs. 1 BGB die Zahlung des (vollständigen) Kaufpreises und gemäß § 273 Abs. 1 BGB die Abnahme der gekauften Sache bis zur Beseitigung des Mangels zu verweigern, soweit sich nicht aus besonderen Umständen ergibt, dass das Zurückbehaltungsrecht in einer gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoßenden Weise ausgeübt wird.*)
IBRRS 2016, 3065
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 26.10.2016 - VIII ZR 240/15
Zur Unzumutbarkeit einer Fristsetzung zur Nachbesserung bei sporadisch auftretenden sicherheitsrelevanten Mängeln eines verkauften Kraftfahrzeugs.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2880
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 12.10.2016 - VIII ZR 103/15
1. § 476 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die dort vorgesehene Beweislastumkehr zugunsten des Käufers schon dann greift, wenn diesem der Nachweis gelingt, dass sich innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang ein mangelhafter Zustand (eine Mangelerscheinung) gezeigt hat, der - unterstellt, er hätte seine Ursache in einem dem Verkäufer zuzurechnenden Umstand - dessen Haftung wegen Abweichung von der geschuldeten Beschaffenheit begründen würde. Dagegen muss der Käufer weder darlegen und nachweisen, auf welche Ursache dieser Zustand zurückzuführen ist, noch dass diese in den Verantwortungsbereich des Verkäufers fällt (im Anschluss an EuGH, 04.06.2015 - Rs. C-497/13, IBRRS 2015, 1859; IMRRS 2015, 0702; Änderung der bisherigen Senatsrechtsprechung; vgl. BGH, 02.06.2004 - VIII ZR 329/03, IBRRS 2004, 1606; IMRRS 2004, 0829, BGHZ 159, 215, 217 f. [Zahnriemen]; BGH, 14.09.2005 - VIII ZR 363/04, NJW 2005, 3490 unter II 1 b bb (1) [Karrosserieschaden]; BGH, 23.11.2005 - VIII ZR 43/05, IBRRS 2006, 1923; IMRRS 2006, 1200 [Turbolader]; BGH, 18.07.2007 - VIII ZR 259/06, IBRRS 2007, 3890; IMRRS 2007, 1757 [defekte Zylinderkopfdichtung]).*)
2. Weiter ist § 476 BGB richtlinienkonform dahin auszulegen, dass dem Käufer die dort geregelte Vermutungswirkung auch dahin zugutekommt, dass der binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang zu Tage getretene mangelhafte Zustand zumindest im Ansatz schon bei Gefahrübergang vorgelegen hat (im Anschluss an EuGH, 04.06.2015 - Rs. C-497/13, IBRRS 2015, 1859; IMRRS 2015, 0702; Aufgabe der bisherigen Senatsrechtsprechung; vgl. BGH, 02.06.2004 - VIII ZR 329/03, IBRRS 2004, 1606; IMRRS 2004, 0829; BGH, 22.11.2004 - VIII ZR 21/04, IBRRS 2005, 0106; IMRRS 2005, 0038; BGH, 14.09.2005 - VIII ZR 363/04, aaO; BGH, 23.11.2005 - VIII ZR 43/05, IBRRS 2006, 1923; IMRRS 2006, 1200; BGH, 21.12.2005 - VIII ZR 49/05, IBRRS 2006, 1838; IMRRS 2006, 1139 [Katalysator]; BGH, 29.03.2006 - VIII ZR 173/05, IBRRS 2006, 1821; IMRRS 2006, 1131[Sommerekzem I]; vgl. BGH, 15.01.2014 - VIII ZR 70/13, IBRRS 2014, 0811 [Fesselträgerschenkelschaden]).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2724
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.09.2016 - 3 U 4/16
Ist hinsichtlich des Kaufgegenstands einer Allwettermarkise mit Funkmotorantrieb vereinbart: "Die 615 ist ... als Wetterschutz konzipiert. Über die minimale Neigung von 14 Grad läuft Regenwasser einfach ab.", so entspricht die gelieferte Markise nicht der vereinbarten Beschaffenheit, wenn die tatsächlich vorhandene Neigung bei Regen nicht den gewünschten Effekt hat, sich nämlich auf ihr Regenwasser staut und dann (ausschließlich) über die Querseiten der Markise abläuft.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2593
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2016 - 5 U 49/15
1. Eine Nacherfüllungsaufforderung i.S.v. § 323 Abs. 1 BGB ist bestimmt und eindeutig unter Benennung des genauen Inhalts des Nacherfüllungsverlangens zu formulieren; die bloße Aufforderung zu einer Erklärung über die Leistungsbereitschaft genügt nicht.*)
2. Dem Verkäufer eines PKW ist die Möglichkeit zur eigenen Prüfung der behaupteten Mängel einzuräumen, wenn er ein diesbezügliches Interesse an eigenen Feststellungen bekundet.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2552
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.09.2016 - 5 U 99/15
1. Erfüllungsort für Nacherfüllungsansprüche hinsichtlich eines im Internet erworbenen und zum Zwecke des Einbaus durch den Käufer in eine Werkstatt versandten Getriebes ist der Ort der Werkstatt.*)
2. Der Käufer einer mangelhaften Sache genügt seiner Pflicht, dem Verkäufer die Untersuchung der Sache zu ermöglichen, indem er diesem auf Aufforderung hierzu Gelegenheit gibt. Ein ausdrückliches Anbieten, die Sache zu überprüfen, ist nicht Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch nach § 433 Abs. 1, § 437 Nr. 3, §§ 440, 280 Abs. 1, § 281 Abs. 1 BGB.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2343
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
OLG Hamm, Urteil vom 04.07.2016 - 22 U 28/16
Die Kosten für die Einholung eines Sachverständigengutachtens, das in Auftrag gegeben wurde, um eine Investitionsentscheidung treffen zu können, werden nicht als vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB) ersetzt, wenn eine Vertragspartei (hier: der Käufer) wegen einer Pflichtverletzung des anderen Vertragspartners (hier: des Verkäufers) vom Vertrag zurücktritt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2308
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Oldenburg, Urteil vom 01.09.2016 - 16 O 790/16
1. Die Beantwortung der Frage, ob eine den Rücktritt ausschließende Pflichtverletzung unerheblich ist, erfordert eine umfassende Interessenabwägung. Zu berücksichtigen sind vor allem der für die Mangelbeseitigung erforderliche Aufwand, aber auch die Schwere des Verschuldens des Verkäufers, wobei bei Arglist eine unerhebliche Pflichtverletzung in der Regel zu verneinen ist.
2. Der Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung indiziert die Erheblichkeit.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2228
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Hamm, Urteil vom 21.07.2016 - 28 U 175/15
1. Zu der Frage, wann der Käufer an eine einmal gewählte Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Nachlieferung) gebunden ist.*)
2. Der Verkäufer kann den Einwand der Unverhältnismäßigkeit der Nachlieferung (§ 439 Abs. 3 BGB) nicht mehr erheben, wenn der Käufer den Rücktritt oder die Minderung erklärt oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt hat.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2089
 AGB
AGB
BGH, Urteil vom 29.06.2016 - VIII ZR 191/15
1. Die Frage, ob eine Erklärung als (rechtsverbindliche) Willenserklärung zu werten ist, beurteilt sich nach den für die Auslegung von Willenserklärungen geltenden Maßstäben (im Anschluss an BGH, Urteile vom 07.11.2001 - VIII ZR 13/01, NJW 2002, 363 unter II 3 b aa = IBR 2002, 113; vom 22.01.2014 - VIII ZR 391/12, NJW 2014, 1951 Rn. 14 = IBRRS 2014, 0740 = IMRRS 2014, 0338). Bei der Abgrenzung einer Allgemeinen Geschäftsbedingung von einer unverbindlichen Erklärung ist daher der für die inhaltliche Auslegung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen geltende Grundsatz der objektiven Auslegung heranzuziehen (im Anschluss an Senatsurteile vom 04.02.2009 - VIII ZR 32/08, BGHZ 179, 319 Rn. 11, 22 = IBR 2009, 1136 - nur online; vom 09.04.2014 - VIII ZR 404/12, BGHZ 200, 362 Rn. 24 f. = IBR 2014, 1292 - nur online).*)
2. Dabei kommt allerdings nicht die Unklarheitenregelung des § 305c Abs. 2 BGB zur Anwendung. Denn diese setzt voraus, dass es sich bei der in Frage stehenden Erklärung um eine Allgemeine Geschäftsbedingung handelt (im Anschluss an Senatsurteil vom 04.02.2009 - VIII ZR 32/08, aaO Rn. 22 mwN = IBR 2009, 1136 - nur online).*)
3. Ob es sich bei einer in einem "verbindlichen Bestellformular" über den Ankauf eines Kraftfahrzeugs vorgedruckten und durch eine individuelle Datumsangabe ergänzte Erklärung "Datum der Erstzulassung lt. Fzg-Brief" um eine rechtsverbindliche Erklärung handelt oder nicht, ist nach objektiven Maßstäben zu entscheiden. Denn für den Fall ihrer Rechtsverbindlichkeit käme allein eine Einordnung als Allgemeine Geschäftsbedingung oder als typische, im Gebrauchtwagenhandel übliche Individualerklärung in Betracht. Auch im letztgenannten Fall gilt ein objektiver, von den Vorstellungen der konkreten Parteien und der Einzelfallumstände losgelöster Auslegungsmaßstab (im Anschluss an BGH, Urteile vom 25.10.1952 - I ZR 48/52, BGHZ 7, 365, 368; vom 29.10.1956 - II ZR 64/56, BGHZ 22, 109, 113).*)
4. Die in einem "verbindlichen Bestellformular" über den Ankauf eines Kraftfahrzeugs vorgedruckte und mit einer individuellen Datumsangabe versehene Erklärung "Datum der Erstzulassung lt. Fzg-Brief" stellt keine auf den Abschluss einer konkludenten Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB über eine bestimmte Höchststandzeit zwischen Herstellung und Erstzulassung des Fahrzeugs oder eine bestimmte Modellreihenzugehörigkeit gerichtete Willenserklärung, sondern allein eine Wissenserklärung dar (im Anschluss an Senatsurteile vom 04.06.1997 - VIII ZR 243/96, BGHZ 135, 393, 398; vom 12.03.2008 - VIII ZR 253/05, NJW 2008, 1517 Rn. 13 = IBRRS 2008, 1162 = IMRRS 2008, 0811; Senatsbeschluss vom 02.11.2010 - VIII ZR 287/09, DAR 2011, 520 Rn. 4 = IBRRS 2011, 0063 = IMRRS 2011, 0054).*)
5. Anders als bei Neuwagen und "Jahreswagen", bei denen vor der Erstzulassung eine Standzeit von höchstens zwölf Monaten hinzunehmen ist (vgl. Senatsurteile vom 15.10.2003 - VIII ZR 227/02, unter II 3 = IBRRS 2003, 3127 = IMRRS 2003, 1401; vom 07.06.2006 - VIII ZR 180/05, NJW 2006, 2694 Rn. 7 ff. = IBRRS 2006, 3290 = IMRRS 2006, 2378), lassen sich bei (sonstigen) Gebrauchtwagen keine allgemein gültigen Aussagen dahin treffen, ab welcher Grenze eine Standzeit zwischen Herstellung und Erstzulassung eine Beschaffenheit darstellt, die nicht mehr üblich ist und die der Käufer auch nicht erwarten musste (Fortentwicklung von Senatsurteil vom 10.03.2009 - VIII ZR 34/08, NJW 2009, 1588 Rn. 14).*)
6. Dem Berufungsgericht ist gemäß § 513 Abs. 1, § 546 ZPO selbst bei - vom Revisionsgericht nur beschränkt überprüfbaren - Individualerklärungen eine unbeschränkte Überprüfung der vorinstanzlichen Vertragsauslegung dahin eröffnet, ob diese bei Würdigung aller dafür maßgeblichen Umstände sachgerecht erscheint (im Anschluss an Senatsurteil vom 14.07.2004 - VIII ZR 164/03, BGHZ 160, 83, 88 ff. = IBRRS 2006, 0129 = IMRRS 2006, 0064).*)
7. Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO tritt eine Bindung des Berufungsgerichts an die Tatsachenfeststellung der ersten Instanz nicht bereits dann ein, wenn diese keine Verfahrensfehler aufweist (im Anschluss an BGH, Urteile vom 09.03.2005 - VIII ZR 266/03, BGHZ 162, 314, 316 f. = IBRRS 2005, 1466 = IMRRS 2005, 0748; vom 07.02.2008 - III ZR 307/05, NJW-RR 2008, 771 Rn. 13 = IBRRS 2008, 0497; IMRRS 2008, 0340). Vielmehr sind auch verfahrensfehlerfrei getroffene Tatsachenfeststellungen für das Berufungsgericht nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nicht bindend, soweit konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen. Solche Zweifel können sich auch aus der Möglichkeit unterschiedlicher Wertungen ergeben (im Anschluss an Senatsurteil vom 09.03.2005 - VIII ZR 266/03, aaO S. 317; BVerfG, NJW 2003, 2524; NJW 2005, 1487).*)
IBRRS 2016, 2056
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 24.03.2016 - I ZR 7/15
1. Bestimmungen, die die Kennzeichnung von Textilprodukten regeln, stellen grundsätzlich dem Schutz der Verbraucher dienende Marktverhaltensregelungen dar.*)
2. Die in Art. 16 Abs. 1 Satz 1 TextilKennzVO bestimmte Pflicht, die in Art. 5 und 7 bis 9 TextilKennzVO aufgeführten Beschreibungen der Textilfaserzusammensetzung in Katalogen, in Prospekten, auf Verpackungen, Etiketten und Kennzeichnungen anzugeben, ist (nur) auf den Zeitpunkt der Bereitstellung eines Textilerzeugnisses auf dem Markt und damit auf jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit bezogen. Wenn ein Textilerzeugnis dem Verbraucher zum Kauf angeboten wird, müssen diese Informationen dem Verbraucher nach Art. 16 Abs. 1 Satz 2 TextilKennzVO zwar schon vor dem Kauf und daher zu dem Zeitpunkt deutlich sichtbar sein, zu dem das Textilerzeugnis dem Verbraucher in Geschäftsräumen präsentiert und zur sofortigen Übergabe nach Kaufabschluss bereitgehalten wird. Keine entsprechenden Informationspflichten bestehen aber in reinen Werbeprospekten ohne Bestellmöglichkeit.*)
3. Vor dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher die in Art. 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 TextilKennzVO genannten Angaben über die Faserzusammensetzung der ihm angebotenen Textilerzeugnisse zu machen sind, stellen diese Angaben auch noch keine wesentlichen Informationen im Sinne von § 5a Abs. 2 und 3 Nr. 1 UWG dar.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2067
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 21.07.2016 - I ZR 26/15
1. Der Unternehmer enthält dem Verbraucher eine Information im Sinne von § 5a Abs. 2 Satz 1 UWG vor, wenn diese zu seinem Geschäfts- und Verantwortungsbereich gehört oder er sie sich mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann und der Verbraucher sie nicht oder nicht so erhält, dass er sie bei seiner geschäftlichen Entscheidung berücksichtigen kann.*)
2. Eine Information ist wesentlich im Sinne des § 5a Abs. 2 UWG, wenn ihre Angabe unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen vom Unternehmer erwartet werden kann und ihr für die vom Verbraucher zu treffende geschäftliche Entscheidung erhebliches Gewicht zukommt.*)
3. Bei der gemäß vorstehend b) vorzunehmenden Interessenabwägung sind auf Seiten des Unternehmers dessen zeitlicher und kostenmäßiger Aufwand für die Beschaffung der Information, die für den Unternehmer mit der Informationserteilung verbundenen Nachteile sowie möglicherweise bestehende Geheimhaltungsbelange zu berücksichtigen.*)
4. Die Frage, ob eine Information für die geschäftliche Entscheidung des Verbrauchers von besonderem Gewicht ist, ist nach dem Erwartungs- und Verständnishorizont des Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen.*)
5. Nach der Lebenserfahrung hat der Hinweis auf ein Prüfzeichen für die geschäftliche Entscheidung des Verbrauchers über den Erwerb des damit versehenen Produkts erhebliche Bedeutung. Der Verbraucher erwartet, dass ein mit einem Prüfzeichen versehenes Produkt von einer neutralen und fachkundigen Stelle auf die Erfüllung von Mindestanforderungen anhand objektiver Kriterien geprüft worden ist und bestimmte, von ihm für die Güte und Brauchbarkeit der Ware als wesentlich angesehene Eigenschaften aufweist.*)
6. Bei Prüfzeichen besteht - ähnlich wie bei Warentests - regelmäßig ein erhebliches Interesse des Verbrauchers zu erfahren, anhand welcher Kriterien diese Prüfung erfolgt ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2061
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 03.03.2016 - I ZR 110/15
1. Die Prüfung, ob die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Rechtsmissbrauchs nach§ 8 Abs. 4 UWG unzulässig ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu erfolgen. In diese Beurteilung sind nach der vorgerichtlichen Abmahnung auftretende Umstände auch dann einzubeziehen, wenn ein rechtsmissbräuchliches Verhalten im Zeitpunkt der Abmahnung nicht festzustellen ist.*)
2. Die durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, S. 2158) in § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG eingefügte Relevanzklausel trägt dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken Rechnung und beinhaltet gegenüber der bisherigen Rechtslage im Hinblick darauf, dass schon bisher im Rahmen des § 3 Abs. 1 UWG aF die Spürbarkeit der Interessenbeeinträchtigung zu prüfen war, keine inhaltliche Änderung.*)
3. Die irreführende Werbung mit einer nicht mehr bestehenden Herstellerpreisempfehlung ist regelmäßig geeignet, den Verbraucher im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Die Preisempfehlung stellt für den Verbraucher eine wesentliche Orientierungshilfe bei der Einschätzung der Vorteilhaftigkeit von Marktangeboten dar.*)
4. Ein Händler, der auf einer Internet-Handelsplattform in seinem Namen ein Verkaufsangebot veröffentlichen lässt, obwohl er dessen inhaltliche Gestaltung nicht vollständig beherrscht, weil dem Plattformbetreiber die Angabe und Änderung der unverbindlichen Preisempfehlung vorbehalten ist, haftet als Täter für den infolge unzutreffender Angabe der Preisempfehlung irreführenden Inhalt seines Angebots.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1965
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 15.06.2016 - VIII ZR 134/15
1. Der durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz an die Stelle des § 459 BGB a.F. getretene § 434 BGB geht von einem wesentlich weiteren Sachmangelbegriff aus, so dass auf diese Vorschrift die enge Beschaffenheitsdefinition des § 459 Abs. 1 BGB a.F. nicht mehr angewendet werden kann.*)
2. Als Beschaffenheit einer Kaufsache im Sinne von § 434 Abs. 1 BGB sind sowohl alle Faktoren anzusehen, die der Sache selbst anhaften, als auch alle Beziehungen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauffassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache haben (Anschluss an BGH, Urteile vom 19.04.2013 - V ZR 113/12, NJW 2013, 1948 Rn. 15 = IBRRS 2013, 1962; vom 30.11.2012 - V ZR 25/12, NJW 2013, 1671 Rn. 10 = IMR 2013, 117 = IBRRS 2013, 0352; Fortführung des Senatsbeschlusses vom 26.08.2014 - VIII ZR 335/13, IBRRS 2014, 3899).*)
3. Das Bestehen einer Herstellergarantie für ein Kraftfahrzeug stellt in der Regel ein Beschaffenheitsmerkmal der Kaufsache nach § 434 Abs. 1 BGB dar, so dass dessen Fehlen - bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen dieser Vorschrift - einen Sachmangel begründet (Abgrenzung zum Senatsurteil vom 24.04.1996 - VIII ZR 114/95, BGHZ 132, 320, 324 ff.).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1954
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 13.07.2016 - VIII ZR 49/15
1. Bei der Beurteilung, ob eine vom Käufer zur Nacherfüllung bestimmte Frist angemessen ist, ist - in den Grenzen des § 475 Abs. 1 BGB - in erster Linie eine Vereinbarung der Parteien maßgeblich (Fortführung von BGH, Urteil vom 06.02.1954 - II ZR 176/53, BGHZ 12, 267, 269 f.). Dabei darf der Käufer eine vom Verkäufer selbst angegebene Frist als angemessen ansehen, auch wenn sie objektiv zu kurz ist.*)
2. Für eine Fristsetzung zur Nacherfüllung gemäß § 323 Abs. 1, § 281 Abs. 1 BGB genügt es, wenn der Gläubiger durch das Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung oder durch vergleichbare Formulierungen - hier ein Verlangen nach schneller Behebung gerügter Mängel - deutlich macht, dass dem Schuldner für die Erfüllung nur ein begrenzter (bestimmbarer) Zeitraum zur Verfügung steht. Der Angabe eines bestimmten Zeitraums oder eines bestimmten (End)Termins bedarf es nicht (Fortführung von BGH, Urteile vom 12.08.2009 - VIII ZR 254/08, IBR 2009, 644 = NJW 2009, 3153; vom 18.03.2015 - VIII ZR 176/14, IBR 2015, 330 = NJW 2015, 2564). Ergibt sich dabei aus den Gesamtumständen, dass ein ernsthaftes Nacherfüllungsverlangen vorliegt, schadet es nicht, dass dieses in höfliche Form einer "Bitte" gekleidet ist.*)
3. Für die Beurteilung, ob die Nacherfüllung für den Käufer unzumutbar ist, sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, insbesondere die Zuverlässigkeit des Verkäufers oder der Umstand, dass der Verkäufer bereits bei dem ersten Erfüllungsversuch, also bei Übergabe, einen erheblichen Mangel an fachlicher Kompetenz hat erkennen lassen und das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien nachhaltig gestört ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 15.04.2015 - VIII ZR 80/14, NJW 2015, 1669 = IBRRS 2015, 1744).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1952
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Hamburg, Urteil vom 01.06.2016 - 304 S 43/15
1. Die fünfjährige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 a BGB greift nur, wenn ein Bauwerk selbst verkauft worden ist.
2. Die fünfjährige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB greift nur, wenn die in ein Bauwerk eingebaute Sache dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Ist nur die eingebaute Sache selbst mangelhaft, ist § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gerade nicht einschlägig.
3. Ist also lediglich der Kombispeicher einer im Internet gekauften und selbst eingebauten Solarthermieanlage defekt, so greift die zweijährige Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.
4. Zwar kann im Kaufrecht die Nacherfüllung in Form von Reparaturarbeiten ein Anerkenntnis im Sinne von § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB darstellen, wenn der Verkäufer diese Nacherfüllungsarbeiten in Anerkennung einer Rechtspflicht vornimmt. Allerdings beschränkt sich dieses in Form einer Nachbesserung erklärte Anerkenntnis regelmäßig nur auf diejenigen Mängel, auf die sich auch die Nacherfüllungsarbeiten beziehen.
5. Eine bereits abgelaufene Verjährungsfrist kann nicht durch Verhandlungen gemäß § 203 BGB gehemmt werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 2004
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 04.02.2016 - I ZR 181/14
1. Die Bestimmung des Art. 4 c der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 stellt eine dem Schutz der Verbraucher dienende Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG dar.*)
2. Die Energieeffizienzklasse eines in einem Internetshop beworbenen Fernsehgerätemodells muss nach Art. 4 Buchst. c der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 nicht auf derselben Internetseite wie die preisbezogene Werbung angegeben werden. Vielmehr genügt es grundsätzlich, wenn die Energieeffizienzklasse auf einer Internetseite angegeben wird, die sich nach Anklicken eines Links öffnet, der in der Nähe der preisbezogenen Werbung angebracht ist und klar und deutlich als elektronischer Verweis auf die Angabe der Energieeffizienzklasse zu erkennen ist.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1867
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Karlsruhe, Urteil vom 19.07.2016 - 12 U 31/16
1. Beim Streckengeschäft hat die handelsrechtliche Mängelrüge grundsätzlich entlang der Kaufvertragsverhältnisse zu erfolgen (Anschluss an BGH, Urteil vom 24.01.1990 - VIII ZR 22/89, BGHZ 110, 130; Abgrenzung zu OLG Frankfurt, IBR 2012, 647).*)
2. Im Fall einer erkannten und genehmigten Falschlieferung besteht für den Käufer Anlass, im Rahmen des § 377 HGB besonders sorgfältig zu untersuchen, ob die gelieferte Ware in den vertragswesentlichen Eigenschaften der bestellten entspricht (Fortführung von BGH, IBR 2016, 312).*)
3. Fragt der Käufer aufgrund eines Mangelverdachts beim Hersteller nach und gibt ihm der Hersteller eine falsche Auskunft, entlastet das den Käufer mit Blick auf die Mängelrüge nach § 377 HGB gegenüber dem Verkäufer nicht. Die Auskunft des Herstellers ist dem Verkäufer grundsätzlich nicht zuzurechnen.*)
IBRRS 2016, 1560
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Hannover, Beschluss vom 22.04.2016 - 17 O 43/15
Dem EuGH wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Ist Artikel 3 Abs. 5 zweiter Spiegelstrich der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter ein Grundsatz des europäischen Verbraucherrechts dahingehend zu entnehmen, dass es bei allen Geschäften mit Bezug auf Verbrauchsgüter zwischen Nichtverbrauchern und Verbrauchern für die Geltendmachung sekundärer Gewährleistungsrechte - insbesondere Schadensersatz - ausreichend ist, dass der gewährleistungspflichtige Nichtverbraucher nicht innerhalb einer angemessenen Frist Abhilfe geschaffen hat, ohne dass es insoweit der ausdrücklichen Setzung einer Frist zur Mangelbeseitigung bedarf?
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1548
 Kaufrecht
Kaufrecht
LG Dessau-Roßlau, Urteil vom 10.03.2016 - 7 S 167/15
Mehr als drei Wochen nach Übergabe ist eine unverzügliche Rüge im Sinne von § 377 HGB nicht mehr gegeben.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1202
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.06.2015 - 21 U 14/15
1. Die angemessene Rügefrist im Sinne des Art. 39 Abs. 1 CISG beträgt regelmäßig einen Monat.*)
2. Zur Erfüllung seiner Rügepflicht muss der Käufer jeden Mangel, aus dem er Rechte herleiten will, deutlich und rechtzeitig für sich rügen, wobei bei größeren Liefermengen auch der ungefähre quantitative Umfang der bemängelten Ware angegeben werden muss. Allgemeine Beanstandungen reichen nicht aus; kommen mehrere mögliche Mängel in Betracht, ist jeder gesondert anzuzeigen.*)
3. In der Aufnahme von Verhandlungen über zu spät angezeigte Vertragswidrigkeiten liegt kein Verzicht auf das Recht, sich auf eine versäumte Rügefrist zu berufen. Selbst das erstmalige Vorbringen des Verspätungseinwandes im Gerichtsverfahren führt dies nicht zur Annahme eines Verzichts oder der Verwirkung.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1175
 Kaufrecht
Kaufrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2015 - 21 U 117/14
1. Die Beweislastumkehr des § 476 BGB ist auch beim Kauf gebrauchter Sachen, insbesondere von Kraftfahrzeugen im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufes anwendbar.*)
2. § 476 BGB beinhaltet lediglich eine Beweiserleichterung dafür, dass ein innerhalb der Sechsmonatsfrist festgestellter Mangel bereits bei Gefahrübergang vorlag, nicht jedoch für das Vorliegen eines Mangels als solchen. Für das Vorliegen des Mangels verbleibt es vielmehr bei der vollen Beweislast des Käufers.*)
3. § 476 BGB greift nicht, wenn es sich bei der als Mangel gerügten Beeinträchtigung um gewöhnlichen Verschleiß und Alterung handelt, da in einem solchen Fall kein Sachmangel vorliegt.*)
4. Der Umstand, dass der Mangel auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist, der auch bereits vor der Übergabe des Fahrzeugs an den Käufer eingetreten sein kann, steht der Vermutung des § 476 BGB nicht entgegen. Der Einwand des Verkäufers, der Käufer habe den Mangel durch einen Bedienungsfehler selbst verursacht, ist nur dann erheblich, wenn der Verkäufer zum einen behauptet, durch diesen Bedienungsfehler sei der angeblich vertragswidrige Zustand alleine verursacht worden und zum anderen die angeblich unsachgemäße Behandlung nicht auch vor Auslieferung des Fahrzeuges an den Käufer, nämlich durch einen Dritten oder den Verkäufer selbst, erfolgt sein kann.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 1103
 Allgemeines Zivilrecht
Allgemeines Zivilrecht
BGH, Urteil vom 16.03.2016 - VIII ZR 146/15
1. Es ist dem freien Willen des Verbrauchers überlassen, ob und aus welchen Gründen er von einem bei einem Fernabsatzgeschäft bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht.*)
2. Ein Ausschluss des Widerrufsrechts wegen Rechtsmissbrauchs oder unzulässiger Rechtsausübung (§ 242 BGB) kommt nur ausnahmsweise - unter dem Gesichtspunkt besonderer Schutzbedürftigkeit des Unternehmers - etwa bei arglistigem oder schikanösem Verhalten des Verbrauchers in Betracht (Bestätigung und Fortführung des BGHG, 25.11.2009 - VIII ZR 318/08, IBRRS 2010, 1484; IMRRS 2010, 1035, BGHZ 183, 235 Rn. 17, 20).*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2016, 0858
 Kaufrecht
Kaufrecht
BGH, Urteil vom 24.02.2016 - VIII ZR 38/15
1. Die Anforderungen an die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit eines Käufers im Rahmen eines beiderseitigen Handelsgeschäfts sind letztlich durch eine Abwägung der Interessen des Verkäufers und des Käufers zu ermitteln (im Anschluss an BGH, Urteil vom 17.09.2002 - X ZR 248/00, BGHReport 2003, 285 unter II 1 b = IBR 2002, 263, 264). Dabei ist einerseits das Interesse des Verkäufers zu berücksichtigen, sich nicht längere Zeit nach der Ablieferung der Sache dann nur schwer feststellbaren Gewährleistungsrechten ausgesetzt zu sehen. Andererseits dürfen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Untersuchung nicht überspannt werden (Bestätigung der Senatsurteile vom 14.10.1970 - VIII ZR 156/68, WM 1970, 1400 unter 3; vom 16.04.1977 - VIII ZR 194/75, NJW 1977, 1150 unter II 2 b; vgl. auch Senatsurteil vom 24.01.1990 - VIII ZR 22/89, BGHZ 110, 130, 138).
2. Der Schuldner, der sich auf den Eintritt der Verjährung als rechtsvernichtenden Umstand beruft, ist darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass die Voraussetzungen der von ihm in Anspruch genommenen Verjährungsvorschrift vorliegen. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn das Gesetz für einen bestimmten Anspruch je nach Fallgestaltung verschieden lange Verjährungsfristen vorsieht (im Anschluss an BGH, Urteile vom 19.01.2006 - III ZR 105/05, BGHZ 166, 29, 33 ff. = IBRRS 2006, 0667 = IMRRS 2006, 0406; vom 20.05.2003 - X ZR 57/02, NJW-RR 2003, 1320 unter 2 b m.w.N. = IBR 2003, 473). Daher trägt der Verkäufer einer Sache, der sich auf den Ablauf der zweijährigen Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beruft, die primäre Darlegungslast und die Beweislast dafür, dass kein Verjährungstatbestand vorliegt (hier: § 438 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BGB), der eine längere Verjährungsfrist vorsieht.*)