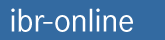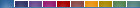Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Volltexturteile nach Sachgebieten
402 Entscheidungen insgesamt
Online seit 2014
IBRRS 2014, 2173 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Naumburg, Urteil vom 26.06.2014 - 2 U 131/13
1. Abgrenzung der Anwendbarkeit von Kaufvertrags- oder Werkvertragsrecht auf einen Vertrag zur Lieferung von Tankbehältern - hier: Anwendung von Werkvertragsrecht, weil der Lieferant eine neue Konstruktion unter Einbeziehung einer vom Besteller beigestellten Abgabeeinheit zu entwickeln hatte.*)
2. Zur Feststellung eines überwiegenden Mitverschuldens des Bestellers für die Mangelhaftigkeit des Endprodukts.*)
3. Ein Unternehmer dann nicht für den Mangel seines Werks verantwortlich, wenn dieser auf verbindliche Vorgaben des Bestellers oder von diesem gelieferte Stoffe oder Bauteile oder Vorleistungen anderer Unternehmer zurückzuführen ist und der Unternehmer seine Prüfungs- und Hinweispflicht erfüllt hat.
4. Der Unternehmer haftet trotz eines Mangels seiner Leistung nicht, wenn er Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer unverzüglich schriftlich mitgeteilt hat. Die insoweit in § 13 Nr. 3 und § 4 Nr. 3 VOB/B getroffenen Regelungen sind eine Konkretisierung von Treu und Glauben, die über den Anwendungsbereich der VOB/B hinaus im Grundsatz auch für den Werkvertrag gelten.
5. Der Rahmen der Prüfungs- und Hinweispflicht und ihre Grenzen ergeben sich aus dem Grundsatz der Zumutbarkeit, wie sie sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalls darstellt. Was hiernach zu fordern ist, bestimmt sich in erster Linie durch das vom Unternehmer zu erwartende Fachwissen und durch alle Umstände, die für den Unternehmer bei hinreichend sorgfältiger Prüfung als bedeutsam erkennbar sind.
6. Auch wenn der Unternehmer den Besteller darauf hingewiesen hat, dass bestimmte Voraussetzungen für sein Werk vorliegen müssen, muss er sich grundsätzlich vor Ausführung seines Werkes vergewissern, ob diese Voraussetzungen eingehalten sind. Regelmäßig kann er sich auch nicht allein deshalb darauf verlassen, dass diese Voraussetzungen vorliegen, weil er sie mit dem Vorunternehmer besprochen hat, sondern er muss dies im Rahmen des ihm Zumutbaren selbstständig prüfen.
IBRRS 2014, 2064
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Naumburg, Urteil vom 24.04.2014 - 2 U 28/13
1. Der Besteller kann den Werkvertrag jederzeit "frei" kündigen. Dem in erster Linie auf die Vergütung gerichteten Interesse des Unternehmers wird im Fall einer solchen Kündigung dadurch Rechnung getragen, dass ihm der Anspruch auf die Gegenleistung im Ausgangspunkt auch für diejenigen Leistungen verbleibt, die er wegen der Kündigung des Vertrags nicht mehr erbringen muss.
2. Die vertragliche Vergütung bei "freier" Kündigung ergibt sich in Ermangelung feststellbaren anderweitigen Erwerbs aus der Differenz zwischen der vereinbarten Vergütung und den kündigungsbedingt für nicht erbrachte Leistungen ersparten Aufwendungen. Erspart sind solche Aufwendungen, die der Unternehmer bei Ausführung des Vertrags hätte machen müssen und die er wegen der Kündigung nicht mehr machen muss.
3. Zur Begründung seines Anspruchs muss der Unternehmer grundsätzlich vortragen, welcher Anteil der vertraglichen Vergütung auf die erbrachten und nicht erbrachten Leistungen entfällt und darüber hinaus vertragsbezogen darlegen, welche Kosten er hinsichtlich der nicht erbrachten Leistungen erspart hat. Erst wenn er eine diesen Anforderungen genügende Abrechnung vorgelegt hat, ist es Sache des Auftraggebers darzulegen und zu beweisen, dass der Unternehmer höhere Ersparnisse erzielt hat, als er sich anrechnen lassen will.
4. Welche Anforderungen an die Abrechnung des gekündigten Werkvertrags zu stellen sind, hängt vom Vertrag sowie den seinem Abschluss und seiner Abwicklung zugrunde liegenden Umständen ab. Sie ergeben sich daraus, welche Angaben der Besteller zur Wahrung seines Interesses an sachgerechter Verteidigung benötigt. Der Unternehmer muss über die kalkulatorischen Grundlagen der Abrechnung so viel vortragen, dass dem für höhere ersparte Aufwendungen darlegungs- und beweisbelasteten Besteller eine sachgerechte Rechtswahrung ermöglicht wird.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 2038
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Wuppertal, Urteil vom 15.05.2014 - 17 O 55/13
Wer zur Beseitigung von Schimmelpilz beauftragt ist, darf den Befall nicht vergrößern. Auf Schadensersatz haftet dieser Sanierer aber erst, wenn nachweisbar ist, dass er die Ausbreitung verursacht hat; eine 50%-Wahrscheinlichkeit reicht nicht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1832
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 05.06.2014 - VII ZR 276/13
1. Der Besteller genügt seiner Darlegungslast, wenn er Mangelerscheinungen, die er der fehlerhaften Leistung des Unternehmers zuordnet, genau bezeichnet. Zu den Ursachen der Mangelerscheinung muss der Besteller nicht vortragen.
2. Zur Darlegung von Mängeln eines Werks, das die Lieferung und Installation von Software zum Gegenstand hat.*)
3. Mit der vorbehaltlosen Zahlung einer Rechnung und der Abgabe einer die Dokumentation betreffende Übernahmeerklärung wird die Leistung jedenfalls dann nicht (konkludent) abgenommen, wenn sie noch nicht voll funktionsfähig ist.
IBRRS 2014, 1744
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
KG, Urteil vom 07.04.2014 - 22 U 86/13
1. Eine doppelte Schriftformklausel kann nicht formlos oder stillschweigend aufgehoben werden, weil andernfalls die Vereinbarung der Einhaltung der Schriftform für die Änderung des Schriftformerfordernisses ihren Sinn verliert.*)
2. Zur Widerlegung der Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Urkunde genügt nicht die bloße Behauptung des Gegenteils, weil andernfalls die Beweisfunktion der Urkunde entwertet würde.*)
3. Bei Vorliegen einer schriftlichen Urkunde gebieten weder der Grundsatz der Waffengleichheit noch eine bestehende Beweisnot die Anhörung oder Vernehmung der (gegen-) beweisbelasteten Partei.*)
4. Die Vermutung in § 649 Satz 3 BGB, dass dem Unternehmer 5% der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen, ergänzt § 649 Satz 2 BGB lediglich und enthält keine abweichende Beweislastverteilung zugunsten des Bestellers, weshalb nur die sekundäre Darlegungslast des Unternehmers erleichtert wird. Die Beweislast höherer ersparter Aufwendungen trägt der Besteller weiterhin bereits nach § 649 Satz 2 BGB.*)
IBRRS 2014, 1592
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Landshut, Urteil vom 02.05.2013 - 41 O 1575/12
Es gibt keine Übung dahingehend, dass der Auftraggeber die Gefahr eines Maschinenbruchs übernimmt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1512
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Frankfurt, Urteil vom 24.01.2013 - 3 U 142/11
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1255
 Bauträger
Bauträger
KG, Urteil vom 10.12.2013 - 7 U 7/13
Ein Bauträger, der einen Werkvertrag mit einem Bauunternehmen als Generalunternehmer abschließt, tut dies nicht, um durch irgendeine Art von Organisation die Arglisthaftung zu vermeiden, sondern deshalb, weil er das Bauwerk überhaupt nicht selbst errichten kann. Er kann deshalb nicht als Werkunternehmer angesehen werden, der die Überwachung und Prüfung des Werks nicht oder nicht richtig organisiert hat und vorhandene Mängel bei richtiger Organisation hätte entdecken können.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1356
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 31.01.2012 - 27 U 109/11
1. Eine Schmiergeldvereinbarung ist grundsätzlich sittenwidrig und nichtig. Die Sittenwidrigkeit ist dabei unabhängig davon, ob dem Vertragspartner Nachteile entstanden sind, weil die Sittenwidrigkeit allein auf dem Vorwurf der Verheimlichung der Zuwendung beruht.
2. Die aus einer Schmiergeldabrede folgende Nichtigkeit erstreckt sich regelmäßig auch auf den durch das Schmiergeld zustande gekommenen Hauptvertrag.
3. Kann die Schmiergeldzahlung auf den Inhalt des Hauptvertrags keinen Einfluss haben, muss der Vertrag objektiv nachteilig sein, um als sittenwidrig angesehen werden zu können. Davon kann nicht ausgegangen werden, wenn keinerlei Anhaltspunkte für einen Nachteil vorliegen, weil - wie etwa im Rahmen eines Architektenvertrags - unstreitig ist, dass das vereinbarte dem (nach HOAI) ohnehin geschuldeten Honorar entspricht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1361
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Hamburg, Urteil vom 29.03.2012 - 13 U 26/07
1. Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf Vergütung zu, wenn er das Werk nicht abnahmereif hergestellt hat.
2. Die Vergütung für das Werk ist von dem Entschädigungsanspruch aus § 642 Abs. 1 BGB nicht erfasst. Der Entschädigungsanspruch gemäß § 642 Abs. 1 BGB hat zwar Entgeltcharakter, er ist jedoch auf Ausgleich der verzugsbedingten Nachteile gerichtet und besteht gegebenenfalls neben einem Anspruch auf Vergütung.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1259
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 28.03.2014 - 7 U 54/13
1. Wird der Auftragnehmer damit beauftragt, in Werkstatt- und Lagerräume eine Heizungsanlage einzubauen, kann der Auftraggeber erwarten, dass eine Raumtemperatur erreicht wird, die bei Werkräumen den rechtlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung entspricht. Das gilt auch dann, wenn die Parteien eine bestimmte Ausführungsart vereinbart haben, mit der diese Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.
2. Lässt sich die geschuldete Funktionstauglichkeit mit der vereinbarten Ausführungsart nicht erreichen und macht dies die Ausführung zusätzlicher Leistungen erforderlich, kann der Auftraggeber die hiermit verbundenen Mehraufwendungen nicht vom Auftragnehmer ersetzt verlangen, wenn sie bei richtiger Planung sowieso angefallen wären.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1261
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Urteil vom 25.03.2014 - 7 U 106/13
Der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers gegen zwei Werkunternehmer als Gesamtschuldner erlischt dadurch, dass der Auftraggeber ihn durch Aufrechnung gegen einen (Rest-)Werklohnanspruch eines Werkunternehmers "verbraucht".
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1272
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Cottbus, Beschluss vom 22.10.2013 - 1 S 51/13
Der infolge des Serverausfalls einer EDV-Anlage entstandene Nacherfüllungsanspruch beschränkt sich nicht nur auf die Einrichtung von "Hardware", sondern beinhaltet ebenso das Aufspielen von "Software" sowie alle zur Wiederherstellung der Datensicherung erforderlichen Maßnahmen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1263
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Beschluss vom 07.01.2014 - 7 U 103/13
1. Wird nicht innerhalb von zwölf Werktagen nach Anzeige der Fertigstellung ein Abnahmetermin anberaumt und die Abnahme nicht ausdrücklich verweigert, ist davon auszugehen, dass auf die vertraglich vereinbarte förmliche Abnahme verzichtet wird. Das gilt erst recht, wenn der Auftraggeber durch vollständige Bezahlung der restlichen Werklohnforderung unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass er gegen die Werkleistung keine Einwände erhebt.
2. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme endgültig und verlangt er auch keine Mängelbeseitigung mehr, entsteht ein Abrechnungsverhältnis und der Werklohnanspruch des Auftragnehmers wird ohne Abnahme fällig.
3. Eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung entfaltet keine Wirkung, wenn es an einer konkreten Mängelrüge fehlt und lediglich allgemein auf ein Gutachten Bezug genommen wird, in dem auch solche Mängel aufgelistet sind, die Leistungen anderer Unternehmer betreffen.
4. Der Auftragnehmer kommt mit der Mängelbeseitigung nicht in Verzug, wenn er eine Sicherheit nach § 648a BGB gefordert hat und der Auftraggeber diese nicht fristgerecht stellt.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1258
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Beschluss vom 14.02.2014 - 7 U 30/13
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1256
 Bauvertrag
Bauvertrag
KG, Beschluss vom 03.01.2014 - 7 U 7/13
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 1159
 Kauf und Werklieferung
Kauf und Werklieferung
LG Landau/Pfalz, Urteil vom 27.02.2014 - 2 O 307/11
1. Bei mehreren zeitlich auseinander liegenden Aufträgen bezüglich eines Bauvorhabens handelt es sich im Zweifel um einen einheitlichen Vertrag.
2. Enthält ein Bauvertrag sowohl Kauf- als auch werkvertragliche Elemente, liegt ein typengemischter Vertrag vor. Die Einordnung des Vertrags als Werk- oder Werklieferungsvertrag mit der Folge der Anwendung der kaufrechtlichen Regeln, beurteilt sich nach dem Schwerpunkt des Vertrags.
3. Bei einem Werklieferungsvertrag, auf welchen das Kaufrecht Anwendung findet, gelten die Regeln über die außerordentliche und die ordentliche Kündigung weder direkt noch analog. Die Baustelle ist nicht Erfüllungsort.
4. Eine Vorleistungspflicht des Unternehmers entfällt. Eine Abnahme der Leistung ist nicht erforderlich.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0877
 Immobilien
Immobilien
AG Bergisch Gladbach, Urteil vom 16.12.2013 - 68 C 404/13
Verlangt der Unternehmer für eine gewöhnliche Türöffnung an einem Werktag zur üblichen Geschäftszeit einen Preis, der den Durchschnittspreis um mehr als 100% und sogar fast um 200% überschreitet, handelt es sich um einen sittenwidrigen Werkvertrag.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0882
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Karlsruhe, Urteil vom 27.08.2013 - 9 U 218/12
Einer Kfz-Werkstatt, die bei einem Fahrzeug 13.000 Euro für die erfolglose Suche nach der Ursache eines Elektronik-Problems aufwendet, steht ein Vergütungsanspruch nur in dem Umfang zu, wie dies vorher mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0648
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.12.2013 - 5 U 135/12
1. Grundsätzlich kann jeder Werkvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden. Eine fristlose Kündigung ist aber nur dann berechtigt, wenn das Vertrauensverhältnis schuldhaft verletzt worden ist, so dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zumutbar ist.
2. Allein das Versäumen eines Termins berechtigt den Auftraggeber nicht zwingend zur Kündigung aus wichtigem Grund, wenn keine Gelegenheit zur Nachholung gewährt worden ist.
3. Die außerordentliche Kündigung eines Werkvertrags kann in eine freie Kündigung umgedeutet werden, wenn der Auftraggeber das Vertragsverhältnis in jedem Fall beenden wollte. In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen sowie Anspruch auf Vergütung der nicht erbrachten Leistungen abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigen Erwerbs.
4. Die Möglichkeit einer freien Kündigung ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Vertrag während der vereinbarten Laufzeit nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0565
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Urteil vom 04.02.2014 - 3 U 819/13
Verlangt der Werkunternehmer nach altem Recht zu Unrecht Abschlagszahlungen ohne darzulegen, auf welchen konkreten Wertzuwachs an der erbrachten Werkleistung diese sich beziehen, und kündigt er mündlich an, seine Arbeiten ohne Zahlung dieser Abschlagszahlungen nicht fortzuführen, rechtfertigt dies nicht die Besteller der Werkleistung sofort den Werkvertrag schriftlich analog § 314 BGB außerordentlich zu kündigen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0278
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Hamburg, Urteil vom 16.08.2013 - 9 U 41/11
Im BGB-Werkvertrag hat der Besteller erst nach der Abnahme einen Anspruch auf Mängelbeseitigung. Tritt der Besteller bereits vor der Abnahme wegen Mängeln vom Vertrag zurück, ist die Berechtigung des Rücktritts anhand der Vorschrift des § 323 BGB zu beurteilen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2014, 0007
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Karlsruhe, Urteil vom 20.12.2013 - 9 S 671/09
Bei der Ermittlung der üblichen Vergütung i.S.v. § 632 Abs. 2 BGB ist regelmäßig nicht auf die betriebswirtschaftliche Angemessenheit abzustellen und hierüber auch kein Beweis zu erheben. Dies gilt auch, wenn die Vergleichsgruppe im Rahmen der Ermittlung der (Orts-)Üblichkeit der Vergütung - bedingt durch die Besonderheiten des Marktes (hier: Nassreinigung) - klein und homogen ist. Wie im Mietwagen-Unfallersatzgeschäft ist der Geschädigte regelmäßig überfordert, wenn ihm über § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB die Aufgabe zugedacht wird, ein Marktversagen zu korrigieren.*)
 Volltext
Volltext
Online seit 2013
IBRRS 2013, 5036 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 05.11.2013 - VI ZR 527/12
Zum Umfang der Haftung im Falle eines Gesundheitsschadens aufgrund eines ärztlichen Befunderhebungsfehlers.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 5017
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 05.11.2013 - XI ZR 25/13
(Ohne amtlichen Leitsatz)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4849
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BAG, Urteil vom 25.09.2013 - 10 AZR 282/12
Gegenstand eines Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 Abs. 2 BGB). Fehlt es an einem vertraglich festgelegten abgrenzbaren, dem Auftragnehmer als eigene Leistung zurechenbaren und abnahmefähigen Werk, kommt ein Werkvertrag kaum in Betracht, weil der "Auftraggeber" dann durch weitere Weisungen den Gegenstand der vom "Auftragnehmer" zu erbringenden Leistung erst bestimmen und damit Arbeit und Einsatz erst bindend organisieren muss.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4745
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Hamm, Urteil vom 11.10.2013 - 12 U 15/13
1. Eine Vertragsklausel, nach der das vereinbarte Entgelt der Preisgleitung in Höhe der Inflationsrate unterliegt, hält im Handelsverkehr der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB stand. Sie bringt im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 PrKlG hinreichend bestimmt zum Ausdruck, dass nicht ausschließlich ein Preisanstieg eine Erhöhung des Vertragsentgelts bewirkt.*)
2. Eine Wirtschaftsklausel ist nicht allein in der Vereinbarung zu sehen, nach der für die geschäftliche Zusammenarbeit die Grundsätze kaufmännischer Loyalität zu gelten haben.*)
3. Wirtschaftsklauseln sind gemäß §§ 133, 157 BGB unter Einschluss des gesamten Vertragsinhalts und der außerhalb der Vertragsurkunde erkennbaren Umstände auszulegen. Diese Vertragsauslegung orientiert sich nicht an den Maßstäben, die beim Wegfall der Geschäftsgrundlage gelten, sondern folgt eigenen Regeln.*)
4. Bereits bei der Auslegung von allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vorrang von Individualvereinbarungen zu beachten. Es kommt deshalb für den Anwendungsbereich einer allgemeinen Geschäftsbedingung auf die Reichweite und damit die Auslegung der Individualvereinbarung an und nicht umgekehrt. Das gilt auch für das Verhältnis von individueller Preisvereinbarung und allgemeiner Wirtschaftsklausel.*)
5. Ob die Regelung einer langjährigen Vertragsbindung in einem Dauerschuldverhältnis den Vertragspartner im Sinne des § 307 Abs. 1 BGB unangemessen benachteiligt, ist anhand einer umfassenden Abwägung der im Einzelfall beachtlichen schutzwürdigen Interessen beider Vertragsparteien zu beurteilen.*)
6. Eine "generalisierende Betrachtungsweise" ist bei der Interessenabwägung nicht ausgeschlossen. Ein der Vertragspartei zuzuerkennendes berechtigtes Interesse an einer langen Vertragslaufzeit kann auch darin begründet liegen, dass die lange Vertragsbindung generell, d.h. unabhängig von den finanziellen Aufwendungen für ein konkretes Vertragsverhältnis erforderlich ist, um ein bestimmtes Produkt wirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten.*)
7. Das dem Besteller gegenüber dem Werkunternehmer grundsätzlich zustehende freie Kündigungsrecht nach § 649 S. 1 BGB ist durch die Vereinbarung einer festen Vertragslaufzeit nicht stets ausgeschlossen. Vielmehr sind insoweit die Umstände des Einzelfalls zu beachten. Hiernach kann dem Unternehmer über die Realisierung seines Vergütungsanspruchs hinaus ein berechtigtes Interesse an der Ausführung der Vertragsleistung zuzubilligen sein, welches durch eine jederzeitige freie Kündigung des Vertrages in einer ihm nicht zuzumutbaren Weise beeinträchtigt werden würde.*)
IBRRS 2013, 4734
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.12.2011 - 10 U 78/06
1. Der Rücktritt von einem Einheitspreisvertrag wegen erheblicher Mehrmengen ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber das Angebot des Auftragnehmers in Kenntnis der Unrichtigkeit der dem Angebot zugrunde gelegten Mengenangaben angenommen hat.
2. Nach den Grundsätzen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens ist es für einen wirksamen Vertragsschluss nicht erforderlich, dass die Verhandlungen tatsächlich zu einer verbindlichen Übereinkunft geführt haben. Es reicht vielmehr aus, dass das Bestätigungsschreiben auf eine getroffene Vereinbarung Bezug nimmt.
3. Durch ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben wird eine gegebenenfalls fehlende Vertretungsmacht geheilt.
4. Auch im Fall der Kündigung setzt die Fälligkeit der Vergütung für erbrachte Teilleistungen grundsätzlich deren Abnahme voraus. Eine Abnahme ist jedoch entbehrlich, wenn der Auftraggeber die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigert.
IBRRS 2013, 4537
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.01.2013 - 21 U 25/10
1. Die Beantwortung der Frage, wer bei einem (vermeintlich) unklaren Angebot Vertragspartner wird, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei darf der Empfänger der Erklärung allerdings nicht einfach den ihm günstigsten Sinn beilegen.
2. Bei den einem Werk- bzw. Kaufvertrag vorangehenden Gesprächen zwischen den späteren Vertragsparteien bzw. deren Vertretern ist es allgemein üblich, dass der Kunde von Seiten des für den Unternehmer oder Verkäufer Auftretenden über die später zu erbringende Leistung bzw. das zu erwerbende Produkt beraten wird. Das allein begründet aber noch keinen eigenständigen Beratervertrag.
3. Die Haftung einer Person, die nicht Vertragspartner wird, setzt nach § 311 Abs. 3 BGB voraus, dass diese in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst hat. Des Weiteren ist ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Vertragsschluss erforderlich. Ein lediglich mittelbares Interesse, etwa die Aussicht auf eine Provision oder ein Entgelt genügt hierfür nicht. Angestellte, Handlungsbevollmächtigte oder Handelsvertreter haften daher nicht aus § 311 Abs. 3 BGB.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 4404
 Architekten und Ingenieure
Architekten und Ingenieure
OLG München, Urteil vom 05.02.2013 - 9 U 2870/12 Bau
Keine (entsprechende) Anwendung von § 255 BGB im Verhältnis des Nachunternehmers zum Hauptunternehmer, wenn der Nachunternehmer behauptet, der Hauptunternehmer habe zu viel Schadensersatz an den Bauherrn geleistet und daher bereicherungsrechtliche Rückforderungsansprüche des Hauptunternehmers sieht.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 3980
 Bauhaftung
Bauhaftung
OLG Köln, Beschluss vom 16.05.2013 - 19 U 9/13
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer bei der Durchführung der beauftragten Leistungen vor Schäden zu bewahren.
2. Im Rahmen der dem Auftraggeber obliegenden Schutzpflicht ist dieser gehalten, die Vorrichtungen und Gerätschaften, die dem Auftragnehmer zur Erledigung der geschuldeten Arbeiten zur Verfügung gestellt werden (hier: eine Steckdose), so bereitzustellen, dass von diesen keine Gefahren für Leib oder Leben ausgehen.
3. Wird eine von einer Fachfirma installierte Steckdose über Jahre hinweg genutzt, ohne dass es zu Stromschlägen gekommen ist, besteht für den Auftraggeber kein Anlass, die dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Steckdose einer versierten Prüfung durch einen Dritten zu unterziehen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 2349
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Heilbronn, Urteil vom 25.04.2013 - 2 O 341/12
1. Ein Vertrag über die Wartung (komplexer) gebäudetechnischer Anlagen kann als Werkvertrag zu qualifizieren sein.
2. Wenn bei einem solchen Vertrag die Vergütung pauschaliert wurde, bestimmen sich die Vergütungsansprüche auch bei fehlerhafter bzw. unvollständiger Wartung nach den werkvertraglichen Regelungen.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 2297
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG München, Urteil vom 26.05.2004 - 7 U 3802/02
Unmöglichkeit ist gleichbedeutend mit genereller Unerfüllbarkeit. Dagegen ist keine Unmöglichkeit gegeben, wenn nur die ursprünglich vorgesehene Erfüllungsart undurchführbar geworden ist, die Leistung aber vom Schuldner in anderer Weise erbracht werden kann und die Änderung beiden Parteien zumutbar ist.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 2218
 Bauvertrag
Bauvertrag
AG Lichtenberg, Urteil vom 19.03.2013 - 18 C 170/12
1. Ein Auftragnehmer, der aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs des Grundstückseigentümers eine Monopolstellung innehat, trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit der Ermessensausübung bei der Festsetzung des Leistungsentgelts gem. § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB.
2. § 30 AVBWasserV erfasst nur die Zahlungsverweigerung aufgrund von Rechen- und Ablesefehlern und nicht die Preisbestimmung des Versorgungsunternehmers.
3. Eine Kostenpauschalisierung bei dem Anschluss von Grundstücken an die Wasserversorgung ist grundsätzlich hinnehmbar (§ 10 Abs. 4 AVBWasserV), gibt es jedoch zwei unterschiedliche Methoden zur Leitungsverlegung (offene und geschlossene Bauweise) mit sich erheblich unterscheidenden Kosten, muss die Leistungsbestimmung dahingehend differenziert werden.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 2208
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Beschluss vom 28.05.2013 - 3 U 1445/12
1. Der Geschäftsführer eines Unternehmens, das ein Labor mit der Entnahme von Bodenproben und deren anschließenden chemischen Analyse sowie der Erstellung von Prüfberichten beauftragt, kann sich hinsichtlich der geschäftlichen Abwicklung eines Werkvertrages nicht auf seine eigene vermeintliche Unkenntnis berufen, sondern muss sich die Kenntnisse seiner sonstigen, mit der Abwicklung der Geschäftsbeziehung betrauten Mitarbeiter als Wissensvertreter gemäß § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen.*)
2. Die Erbringung einer Abschlagszahlung auf offene Rechnung kann ein Anerkenntnis der in den Rechnungen aufgeführten Positionen darstellen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 2207
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Koblenz, Beschluss vom 29.04.2013 - 3 U 1445/12
1. Der Geschäftsführer eines Unternehmens, das ein Labor mit der Entnahme von Bodenproben und deren anschließenden chemischen Analyse sowie der Erstellung von Prüfberichten beauftragt, kann sich hinsichtlich der geschäftlichen Abwicklung eines Werkvertrages nicht auf seine eigene vermeintliche Unkenntnis berufen, sondern muss sich die Kenntnisse seiner sonstigen, mit der Abwicklung der Geschäftsbeziehung betrauten Mitarbeiter als Wissensvertreter gemäß § 166 Abs. 1 BGB zurechen lassen.*)
2. Die Erbringung einer Abschlagszahlung auf offene Rechnung kann ein Anerkenntnis der in den Rechnungen aufgeführten Positionen darstellen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 1736
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Dresden, Urteil vom 06.03.2013 - 13 U 545/12
1. § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) enthält keine Verpflichtung des Auftragnehmers zur Vorlage (sozial-)versicherungsrechtlicher Nachweise beim Auftraggeber. Eine Vorlageverpflichtung ergibt sich auch nicht daraus, dass der Auftraggeber wegen der sich aus § 14 AEntG ergebenden Regressgefahr ein erhebliches Interesse an den Unterlagen hat. Vielmehr muss diese Vorlage ausdrücklich vertraglich vereinbart sein.
2. Bei der Abgrenzung zwischen Dienst- und Werkvertrag im Hinblick auf Stundenlohnarbeiten ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln, ob die Herstellung eines bestimmten Werks geschuldet ist, was bei Helfertätigkeiten durch nachhaltige erfolgsorientierte Leistung nachzuweisen ist. Dies kann nur dadurch geschehen, indem die Herstellung eines bestimmten Teils des Bauwerks oder eines Gewerks in Auftrag gegeben wurde.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 1675
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BFH, Urteil vom 18.10.2012 - VI R 65/10
Die durch das WachstumsStG geregelte Verdoppelung des Höchstbetrags für Handwerkerleistungen ist erstmals bei Aufwendungen anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum 2009 geleistet und deren zugrunde liegende Leistungen nach dem 31. Dezember 2008 erbracht worden sind.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 1622
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
AG Königstein, Urteil vom 06.03.2013 - 21 C 1326/11
1. Vergisst ein Unternehmer in der Schlussrechnung den vereinbarten Rabatt von dem Endbetrag abzuziehen, wird die Vergütung trotzdem fällig, wenn das Werk abgenommen wird und der Besteller den Unternehmer auf den fehlenden Rabatt nicht hinweist.
2. Die Fälligkeit des Werklohnanspruchs wird nicht dadurch gehindert, dass dem Besteller möglicherweise ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines Anspruchs auf eine Rechnung im Sinne von § 14 UStG zusteht.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 0973
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
KG, Urteil vom 26.10.2012 - 21 U 133/11
1. In einem Dauerschuldverhältnis ist ein Grund zur Kündigung aus wichtigem Grund regelmäßig dann gegeben, wenn der Fall einer nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung vorliegt. Gibt das Gesetz dem Auftraggeber in einem solchen Fall das Recht, sich vom Vertrag zu lösen und Rückabwicklung bereits erbrachter Leistungen verlangen, ist erst recht eine Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Wirkung nur für die Zukunft möglich.
2. Ein eingetretener Verzug endet durch den Erwerb eines Zurückbehaltungsrechts wegen Mängeln nicht automatisch. Vielmehr muss der Auftraggeber, der sich in Zahlungsverzug befindet, zuerst die offene Forderung begleichen, bevor er sich auf ein solches Zurückbehaltungsrecht berufen kann.
IBRRS 2013, 0890
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 24.01.2013 - VII ZR 98/12
Einem Landwirt, der einen Unternehmer damit beauftragt, Lagerraps auf seinem 6,44 ha großen Feld zu dreschen, ist auch unter Berücksichtigung der werkvertraglichen Fürsorgepflicht nicht zumutbar, vor Ausführung der Arbeiten das Feld daraufhin zu untersuchen, ob Fremdkörper oder Werkzeuge aus dem Boden herausragen, die zu einer Schädigung des Mähdreschers führen könnten, wenn dafür keine greifbaren Anhaltspunkte vorliegen.*)
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 0862
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Zweibrücken, Urteil vom 07.02.2013 - 4 U 78/12
Auch wenn bei einem Werkvertrag das Werk am Firmensitz des ausländischen Auftragnehmers hergestellt werden soll, kann durch allgemeine Geschäftsbedingungen der inländische Firmensitz des Auftraggebers als Erfüllungsort vereinbart werden.*)
IBRRS 2013, 0825
 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
OLG Celle, Urteil vom 05.07.2012 - 6 U 22/12
Fordert ein Dritter den Gläubiger aus einem Werkvertrag dazu auf, eine Rechnung anstatt auf den Namen des Schuldners auf seinen eigenen Namen umzuadressieren, so stellt diese Aufforderung dann keinen Antrag auf Abschluss eines Schuldbeitrittsvertrags dar, wenn weitere Beweggründe des Erklärenden möglich sind.
 Volltext
Volltext
IBRRS 2013, 0819
 Bauvertrag
Bauvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 06.11.2012 - 21 U 75/11
1. Ein an sich voll funktionsfähiges Umluftkühlsystem ist mangelhaft, wenn es nicht den vertraglichen Vorgaben entspricht und es deshalb nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
2. Ein Vertrag über die Lieferung und Montage eines speziellen Kanalumluftsystems ist ein Werklieferungsvertrag, so dass Kaufrecht Anwendung findet. Denn Kaufrecht ist auf sämtliche Verträge mit einer Verpflichtung zur Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen anzuwenden. Dem Werkvertragsrecht unterfallen demgegenüber im Wesentlichen die Herstellung von Bauwerken, reine Reparaturarbeiten und die Herstellung nicht körperlicher Werke, wie die Planung von Architekten oder die Erstellung von Gutachten.
3. Noch zu montierende Anlagenteile muss der Käufer nicht bereits bei der Anlieferung untersuchen und etwaige Mängel rügen. Ob der Käufer seiner kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht nachgekommen ist, ist nach dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme der Anlage zu beurteilen.
 Volltext
Volltext
Online seit 2012
IBRRS 2012, 4771 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
LG Bonn, Urteil vom 28.11.2011 - 1 O 154/11
Bei einem Vertrag über die Durchführung von Reinigungsarbeiten handelt es sich um einen Werkvertrag im Sinne von § 631 BGB. Geschuldet wird also nicht nur ein Bemühen, sondern ein konkreter Erfolg. Bei Mängeln der Reinigungsleistung ist nachzuarbeiten.
 Volltext
Volltext
Online seit 2011
IBRRS 2011, 4094 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 23.01.1996 - X ZR 63/94
Entsteht bei einem Werkvertrag mit Höchstpreisgarantie Streit, welche Leistungen zu diesem Preis zu erbringen waren, dann trägt der Unternehmer, der für bestimmte Leistungen eine zusätzliche Vergütung fordert, insoweit die Beweislast.
 Volltext
Volltext
Online seit 2003
IBRRS 2003, 4145 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Köln, Urteil vom 20.03.2003 - 7 U 117/02
1. Auch der nachträgliche Einbau einer Heizungsanlage in ein bestehendes Gebäude ist als Arbeiten an einem Bauwerk anzusehen. Gleiches gilt für eine umfassende Sanierung, die sich auf die wesentlichen Teile der Anlage erstreckt und dabei insbesondere auch in die Bauwerkssubstanz eingreift.
2. Anders kann es zu beurteilen sein, wenn nur einzelne Teile einer Heizungsanlage im Wege einer Reparatur ausgetauscht oder erneuert werden. Von entscheidender Bedeutung ist dabei neben dem Gesamtumfang der Maßnahme, ob und inwieweit die Gebäudesubstanz berührt und betroffen wird bzw. wie sich die Verbindung zum Gebäude gestaltet, denn besonderer Zweck der Verjährungsregelung bei Gebäuden ist, dass sich Mängel bei Gebäudearbeiten oftmals erst später und schwerer als sonst erkennen lassen und für die Gebäudesubstanz besonders nachteilig sein können.
3. Bei einem Austausch des Heizkessels und der Umstellung von einem offenen in ein geschlossenes Heizsystem handelt es sich nicht um Arbeiten an einem Bauwerk.
 Volltext
Volltext
Online seit 2002
IBRRS 2002, 0484 Werkvertragsrecht
Werkvertragsrecht
BGH, Urteil vom 29.01.2002 - X ZR 231/00
1. Die Vorschrift des § 641 Abs. 1 BGB knüpft die Fälligkeit des Werklohns zwar an die Abnahme des Werks. Es steht den Parteien aber grundsätzlich frei, eine davon abweichende Fälligkeitsregelung zu treffen.
2. Die Parteien eines Werkvertrags können die Fälligkeit des Werklohnanspruchs dem jeweiligen Leistungsstand anpassen, Abschlagzahlungen und sogar Vorauszahlungen auf die Vergütung vereinbaren sowie die Fälligkeit der Werklohnforderung von der Erteilung einer prüffähigen Rechnung abhängig machen.
 Volltext
Volltext
Online seit 1999
IBRRS 1999, 0964 Werkvertrag
Werkvertrag
LG Kassel, Urteil vom 18.10.1990 - 1 S 482/90
Verzug bei der Montage einer Einbauküche läßt für den Besteller keinen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung entstehen, da es sich bei der Küche um eine erst zu erstellende Sache handelt.
 Volltext
Volltext
Online seit 1998
IBRRS 1998, 0823 Werkvertrag
Werkvertrag
OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.04.1998 - 22 U 47/97
1. Auch wenn zwischen den Parteien eines Werkvertrags nicht ausdrücklich vereinbart wird, wie der Unternehmer die Leistung auszuführen hat, ist das Werk mangelhaft, wenn es nicht den Regeln des Handwerks entspricht.
2. Eine Abweichung von den Regeln des Handwerks bedarf einer ausdrücklichen Anweisung des Bestellers.
 Volltext
Volltext